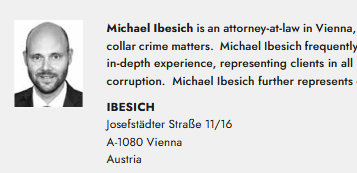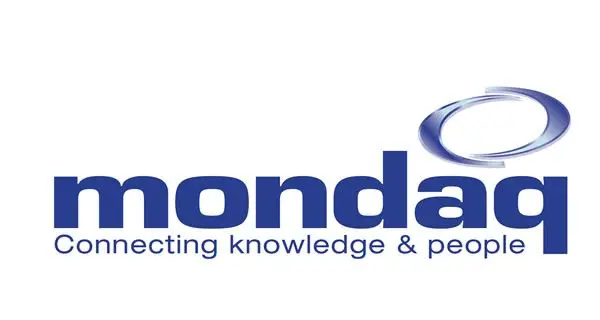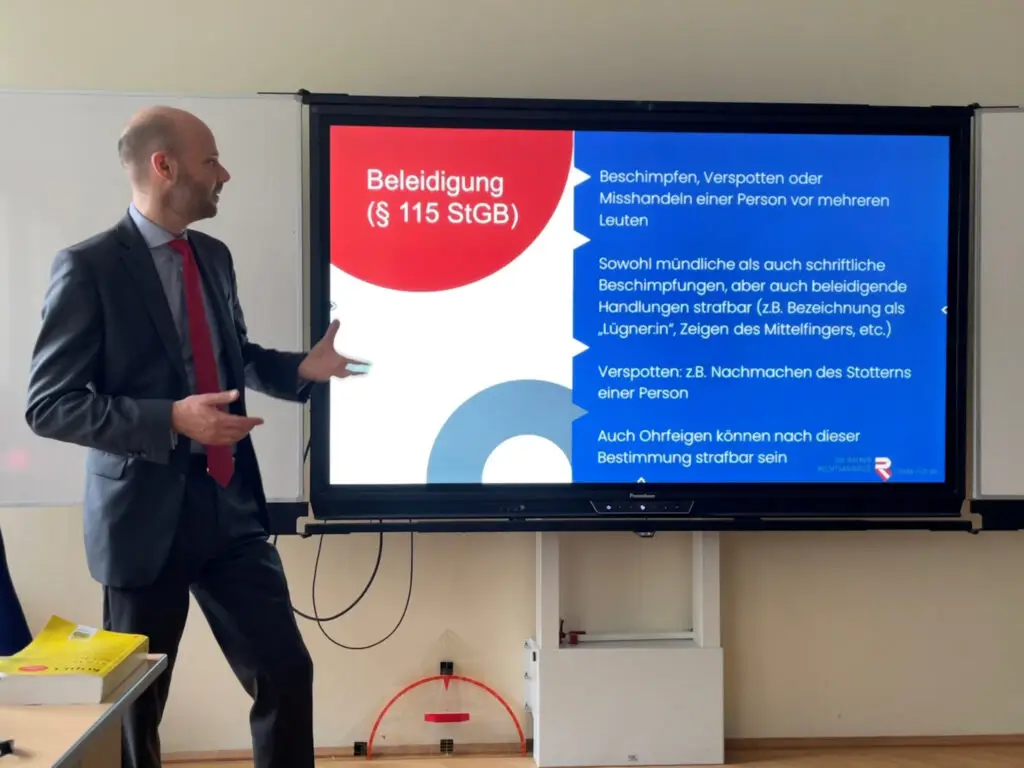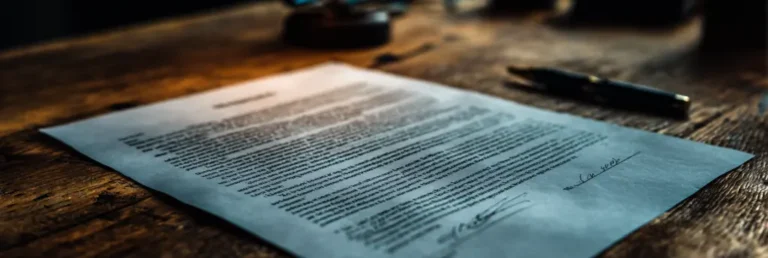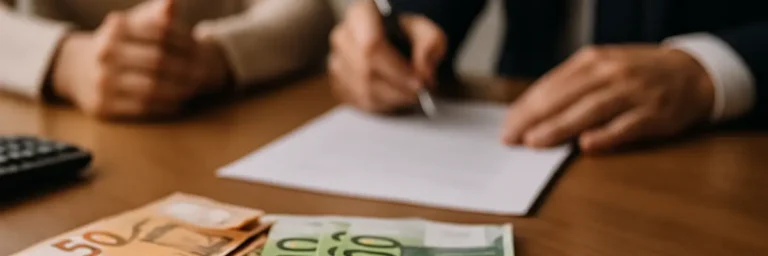Scheidung in Österreich

Rechtsanwalt, spezialisiert auf Familienrecht & Scheidungen, Inhaber der Kanzlei IBESICH
Rechtlicher Hinweis/Disclaimer: Die folgenden Informationen dienen einer ersten Orientierung und ersetzen keine individuelle Rechtsberatung. Bitte wenden Sie sich für eine auf Ihren Einzelfall zugeschnittene Beratung an einen Rechtsanwalt oder eine andere qualifizierte Beratungsstelle.
Eine Scheidung ist ein bedeutsamer Einschnitt im Leben. Wer in Österreich vor einer Scheidung steht, sollte seine Rechte und Möglichkeiten im Scheidungsrecht kennen.
Auf dieser Seite finden Sie einen umfassenden Überblick zu allen wichtigen Aspekten einer Scheidung in Österreich – vom Einreichen der Scheidung über einvernehmliche und strittige Scheidungsverfahren bis hin zu Vermögensaufteilung, Unterhalt, Obsorge und Scheidungskosten. Die Informationen sind aktuell und fachlich geprüft, damit Sie gut informiert Ihre nächsten Schritte planen können.
Beachten Sie jedoch, dass sich gesetzliche Regelungen und Gebühren ändern können.
Das Wichtigste in Kürze
- Scheidung einreichen: beim zuständigen Bezirksgericht einzureichen, entweder einvernehmlich oder strittig.
- Wichtige Unterlagen: Heiratsurkunde, Geburtsurkunden der Kinder, Nachweise über Vermögen/Schulden.
- Einvernehmliche Scheidung: Schneller, weniger kostspielig, allerdings Einigung in allen Punkten nötig.
- Strittige Scheidung: Gericht klärt Verschulden und Scheidungsgrund, meist zeitaufwändiger und teurer.
- Obsorge & Unterhalt: Kindesunterhalt (Alimente) und Obsorgeregelung zum Wohl der Kinder; Ehegattenunterhalt je nach Verschuldensprinzip.
- Vermögensaufteilung: Geregelte Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und Ersparnissen, gesondertes Verfahren falls keine Einigung.
- Kosten: Gerichtsgebühren (aktuell rund 400 EUR pro Antrag), ggf. Anwalts- und Zusatzkosten (Notar, Gutachter, etc.).
Inhaltsverzeichnis
Scheidung einreichen
Der erste Schritt ist das Einreichen der Scheidung beim zuständigen Gericht.
In Österreich sind für Scheidungsverfahren die Bezirksgerichte zuständig – in der Regel jenes Bezirksgericht, in dessen Sprengel die Ehepartner zuletzt gemeinsam gewohnt haben.
Die Scheidung kann entweder als Scheidungsantrag einvernehmlich gemeinsam durch beide Ehepartner gestellt werden oder als Scheidungsklage von einem Ehepartner gegen den anderen, falls keine Einigung besteht.
Form: Die Scheidung kann schriftlich eingereicht oder zu bestimmten Zeiten direkt am Gericht mündlich zu Protokoll gegeben werden.
Für eine einvernehmliche Scheidung gibt es ein eigenes Formular (Antrag auf einvernehmliche Scheidung), das verwendet werden kann.
Bei einer strittigen Scheidung reicht ein Ehepartner die Scheidungsklage ein, in der der Scheidungsgrund angegeben werden muss.
Voraussetzungen prüfen: Bereits vor dem Einreichen sollten die rechtlichen Voraussetzungen geklärt sein. Bei einer einvernehmlichen Scheidung müssen die Ehegatten z. B. seit mindestens sechs Monaten getrennt (im Sinne einer zerrütteten Beziehung) sein und sich über die Scheidungsfolgen einig sein.
Bei einer strittigen Scheidung muss ein gesetzlicher Scheidungsgrund vorliegen.
Erforderliche Unterlagen: Beim Einreichen der Scheidung sollten wichtige Dokumente beigefügt werden. Typische Unterlagen sind:
- Heiratsurkunde (Nachweis der Eheschließung)
- Geburtsurkunden gemeinsamer Kinder (falls vorhanden)
- Meldebestätigungen oder Staatsbürgerschaftsnachweise beider Ehepartner
- Amtliche Lichtbildausweise (z. B. Reisepass oder Personalausweis)
- Ggf. Nachweise über Vermögenswerte, die bei der Scheidung aufgeteilt werden sollen (z. B. Grundbuchauszug für eine Immobilie, Zulassungsschein für ein Auto)
- Ggf. eine ausformulierte Scheidungsfolgenvereinbarung (bei einvernehmlicher Scheidung), in der bereits alle Folgen wie Unterhalt, Obsorge etc. geregelt sind
Nach Einbringung der Scheidung stellt das Gericht die Unterlagen dem anderen Ehepartner zu (sofern nicht gemeinsam eingereicht) und terminiert eine Gerichtsverhandlung.
In diesem Termin werden je nach Verfahrensart die weiteren Schritte gesetzt – entweder die Scheidung einvernehmlich ausgesprochen oder in einem strittigen Verfahren Beweise erhoben und der Scheidungsgrund geprüft.
Wie eine Scheidung korrekt eingereicht wird, worauf Sie unbedingt achten müssen und welche Fehler Sie vermeiden sollten finden Sie in unserem Artikel: Scheidung einreichen
Einvernehmliche Scheidung
Die einvernehmliche Scheidung ist der schnellste und konfliktärmste Weg, eine Ehe zu scheiden.
Hierbei sind sich beide Ehepartner einig, dass die Ehe unheilbar zerrüttet ist.
Wichtigste Voraussetzung ist, dass die eheliche Lebensgemeinschaft seit mindestens einem halben Jahr aufgehoben ist (Trennungsphase).
Beide Seiten stellen dann gemeinsam einen Scheidungsantrag beim Bezirksgericht.
Für die einvernehmliche Scheidung schreibt das Gesetz vor, dass die Ehegatten eine Vereinbarung über alle Scheidungsfolgen schließen.
In dieser Scheidungsfolgenvereinbarung müssen folgende Punkte geregelt sein:
- Vermögensaufteilung
- Wie wird das gemeinsame Vermögen und die Schulden verteilt?
- Wie wird das gemeinsame Vermögen und die Schulden verteilt?
- Ehegattenunterhalt
- Werden Unterhaltszahlungen vereinbart oder gegenseitig verzichtet?
- Werden Unterhaltszahlungen vereinbart oder gegenseitig verzichtet?
- Obsorge und Kindesunterhalt
- Bei gemeinsamen minderjährigen Kindern: Wie erfolgt die Obsorge? Wer leistet Alimente?
- Bei gemeinsamen minderjährigen Kindern: Wie erfolgt die Obsorge? Wer leistet Alimente?
- Kontaktrecht
- Besuchs- oder Kontaktregelungen für das Elternteil, bei dem das Kind nicht hauptsächlich lebt.
- Besuchs- oder Kontaktregelungen für das Elternteil, bei dem das Kind nicht hauptsächlich lebt.
Diese Vereinbarung kann schriftlich vorgelegt oder im Scheidungstermin zu Protokoll gegeben werden.
Das Gericht prüft, ob die Vereinbarung fair und vollständig ist und ob das Kindeswohl gewahrt bleibt.
Ablauf: Beide Ehepartner müssen persönlich bei der Verhandlung erscheinen. Der Richter oder die Richterin vergewissert sich, dass beide die Scheidung wirklich wollen.
Liegen alle Voraussetzungen vor, ergeht ein Scheidungsbeschluss. Dieser wird nach Rechtskraft wirksam.
Elternberatung: Bei minderjährigen Kindern ist eine Elternberatung Pflicht, um die Bedürfnisse der Kinder zu berücksichtigen.
Ohne Nachweis dieser Beratung kann die einvernehmliche Scheidung nicht ausgesprochen werden.
Wie eine einvernehmliche Scheidung abläuft, welche Voraussetzungen gelten, worauf Sie unbedingt achten sollten und welche Fehler Sie vermeiden sollten, finden Sie in unserem Artikel: Einvernehmliche Scheidung.

Strittige Scheidung
Von einer strittigen Scheidung spricht man, wenn keine einvernehmliche Lösung gefunden werden kann und die Scheidung gerichtlich durchgesetzt werden muss.
Dann erhebt ein Ehepartner eine Scheidungsklage gegen den anderen.
Typische Scheidungsgründe sind:
- Scheidung aus Verschulden: z. B. Ehebruch, häusliche Gewalt, schwere Kränkungen.
- Langjährige Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft (Zerrüttungsscheidung): in der Regel nach drei bzw. sechs Jahren getrennter Lebensführung.
- Besondere Gründe: bspw. psychische Krankheiten oder bestimmte andere Umstände, die die Ehe unheilbar belasten.
Ablauf: Im strittigen Verfahren erhebt ein Ehepartner Klage und muss den Scheidungsgrund beweisen.
Das Gericht prüft, ob ein Verschulden oder eine unzumutbare Härte vorliegt.
Der Prozess kann Beweisaufnahmen, Zeugenaussagen oder Gutachten umfassen. Am Ende erlässt das Gericht ein Scheidungsurteil.
Folgefragen (Vermögen, Unterhalt, Obsorge): Diese werden oft in separaten Verfahren geklärt, wenn keine Einigung erzielt werden konnte.
Wie eine strittige Scheidung abläuft, welche typischen Streitpunkte es gibt, worauf Sie achten müssen und welche Fehler Sie vermeiden sollten, finden Sie in unserem Artikel: Strittige Scheidung

Vermögensaufteilung
Während der Ehe gilt grundsätzlich Gütertrennung. Mit der Scheidung kommt es zur Aufteilungsregelung für das „eheliche Gebrauchsvermögen“ und die „ehelichen Ersparnisse“.
Nicht alles wird aufgeteilt; bspw. vor der Ehe eingebrachtes Vermögen, Schenkungen oder Erbschaften, persönliche Gegenstände oder berufliche Utensilien sind ausgenommen.
Ablauf des Aufteilungsverfahrens: Oft einigen sich die Ehegatten selbst in einer Scheidungsfolgenvereinbarung. Andernfalls entscheidet das Gericht. Es berücksichtigt dabei u. a.:
- Beitrag zum Erwerb des Vermögens (inkl. Haushaltsführung, Kindererziehung etc.)
- Dauer der Ehe
- Wirtschaftliche Verhältnisse nach der Scheidung
- Verschulden am Scheitern der Ehe (in gewissem Ausmaß)
Ein Antrag auf Aufteilung muss innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der Scheidung gestellt werden, sonst ist er verwirkt.
Mit dem Thema Vermögensaufteilung haben wir uns in folgendem Artikel ausführlich befasst: Vermögensaufteilung bei Scheidungen
Unterhalt & Alimente
Die finanzielle Absicherung nach der Scheidung betrifft den Unterhalt für gemeinsame Kinder (Alimente) und ggf. den Ehegattenunterhalt.
Kindesunterhalt (Alimente)
Leben die Kinder überwiegend bei einem Elternteil, leistet der andere Elternteil Geldunterhalt (Alimente). Die Höhe richtet sich nach dem Einkommen und Alter des Kindes (Regelbedarfssätze).
Eine Anpassung der Höhe der Alimente muss jeweils beantragt werden, dies ist auch rückwirkend möglich.
Unterhaltspflicht besteht bis zur Selbsterhaltungsfähigkeit des Kindes.
Ehegattenunterhalt nach der Scheidung
Hier kommt es stark auf die Verschuldensfrage an.
Grundsätzlich gilt: Wer die Hauptschuld am Scheitern der Ehe trägt, kann zur Zahlung verpflichtet werden. Bei gleichteiligem Verschulden gibt es meist keinen Unterhaltsanspruch, außer in Härtefällen.
In der Praxis gibt es auch Unterhaltsansprüche aufgrund sozialer Aspekte (z. B. Betreuungsunterhalt bei kleinen Kindern).
In unserem weiterführenden Artikel erfahren Sie weitere wertvolle Informationen zu diesem Thema: Unterhalt & Alimente.
Weiters haben Sie die Möglichkeit unseren Unterhaltsrechner zu nutzen.
Obsorge
Gemeinsame Obsorge (Sorgerecht) bleibt in Österreich grundsätzlich auch nach einer Scheidung bestehen, sofern das Wohl des Kindes nicht gefährdet ist.
Wichtig ist die Regelung, bei welchem Elternteil der hauptsächliche Aufenthaltsort des Kindes liegt.
Der andere Elternteil behält gewöhnlich ein Kontakt- bzw. Besuchsrecht.
Bei Uneinigkeit entscheidet das Gericht im „Außerstreitverfahren“. Das Wohl des Kindes steht immer an erster Stelle.
Oft wird die Kinder- und Jugendhilfe (Jugendamt) oder ein Mediationsverfahren eingebunden, um einvernehmliche Lösungen zu finden.
Ausführliche Infos zu Obsorge, Kontaktrecht und Lösungen bei einer Scheidung mit Kindern stehen auf unser Detailseite bereit: Kinder & Obsorge

Scheidungskosten
Die Kosten setzen sich aus mehreren Bestandteilen zusammen:
- Gerichtsgebühren
- Bei einvernehmlicher Scheidung ca. 768 € Gesamtkosten (Antrag + Protokollierung).
Bei strittigen Verfahren (Scheidungsklage) ca. 410 € für die Klage, ggf. weitere Gebühren für Vergleiche etc.
- Bei einvernehmlicher Scheidung ca. 768 € Gesamtkosten (Antrag + Protokollierung).
- Anwaltskosten
- Kein Anwaltszwang in erster Instanz, aber meist empfehlenswert. Kosten je nach Vereinbarung (Tarif, Stundensatz, Pauschale etc.).
Im strittigen Verfahren muss der Unterliegende meist die Kosten der Gegenseite übernehmen.
- Kein Anwaltszwang in erster Instanz, aber meist empfehlenswert. Kosten je nach Vereinbarung (Tarif, Stundensatz, Pauschale etc.).
- Sonstige Kosten
- Kosten für notarielle Beglaubigungen (z. B. Scheidungsvereinbarungen), Mediationsgebühren, Sachverständigengutachten etc.
- Kosten für notarielle Beglaubigungen (z. B. Scheidungsvereinbarungen), Mediationsgebühren, Sachverständigengutachten etc.
- Verfahrenshilfe
- Bei geringem Einkommen kann die Partei einen Antrag auf Verfahrenshilfe stellen. Wenn die Prüfung durch das Gericht erfolgreich war und die Angelegenheit nicht mutwillig oder aussichtslos ist, wird ein Rechtsanwalt beigestellt.
- Bei geringem Einkommen kann die Partei einen Antrag auf Verfahrenshilfe stellen. Wenn die Prüfung durch das Gericht erfolgreich war und die Angelegenheit nicht mutwillig oder aussichtslos ist, wird ein Rechtsanwalt beigestellt.
Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, ist eine einvernehmliche Lösung meist ratsam, sofern möglich. Jedoch sollten berechtigte Ansprüche nicht allein aus Kostengründen aufgegeben werden.
Scheidung ohne Anwalt
Sie können sowohl Ihre einvernehmliche als auch strittige Scheidung ohne Anwalt durchführen.
Allerdings bringt eine Scheidung oft weitreichende rechtliche und finanzielle Konsequenzen mit sich. Besonders bei gemeinsamen Kindern müssen wichtige Fragen wie Obsorge und Kontaktrecht geklärt werden.
Weitere wesentliche Punkte sind die Themen Unterhalt und Vermögensaufteilung
Ein erfahrener Scheidungsanwalt kann Sie bei jeder Form der Scheidung kompetent begleiten, für rechtliche Klarheit sorgen und helfen, folgenschwere Fehler oder rechtliche Nachteile zu vermeiden.
Häufige Fragen zur Scheidung in Österreich
Wann und unter welchen Voraussetzungen kann eine Ehe geschieden werden?
Nach österreichischem Scheidungsrecht existieren zwei wesentliche Formen der Scheidung: die Verschuldensscheidung und jene aus sonstigen Gründen (ehezerrüttendes Verhalten).
Beim Verschuldensprinzip steht im Vordergrund, dass für den unschuldigen Ehepartner ein gemeinsames Zusammenleben aufgrund einer schweren Pflichtverletzung des anderen Partners untragbar geworden ist.
Eine Ehe gilt als unheilbar zerrüttet, wenn ihre Lebensgemeinschaft so stark zerbrochen ist, dass eine Wiederherstellung einer ehetypischen Lebensgemeinschaft nicht mehr zumutbar erscheint. Dabei reicht reines Verschulden allein nicht aus – es muss stets eine tiefgreifende Zerrüttung vorliegen.
In welchen Fällen ist eine Verschuldensscheidung möglich?
Eine Scheidung wegen Verschuldens kann beantragt werden, wenn der Ehepartner durch eine gravierende Verletzung ehelicher Pflichten oder durch sittlich verwerfliches bzw. ehrloses Verhalten schuldhaft eine tiefgehende Zerrüttung der Ehe verursacht hat, sodass eine Wiederherstellung einer dem Eheverständnis entsprechenden Gemeinschaft unzumutbar erscheint.
Schwere Verfehlungen können hierbei Ehebruch, körperliche Gewalt oder die grundlose Verweigerung des Geschlechtsverkehrs einschließen. Aber auch das grundlose Verlassen des gemeinsamen Haushalts, die grobe Vernachlässigung der Kindererziehung oder das konsequente Unterlassen von Besuchen während eines langen Spitalsaufenthalts kommen in Betracht.
Entscheidend ist, dass die Verfehlung schuldhaft begangen wurde und kausal für die Zerrüttung ist.
Unsittlich oder ehrlos kann ein Verhalten sein, wenn der Ehepartner ohne Zustimmung des anderen eine schwere Straftat begangen hat oder der Prostitution oder Zuhälterei nachgeht.
Liegt Verschulden vor, wird dieses gerichtlich ausgesprochen (Verschuldensausspruch) und hat insbesondere Auswirkungen auf den nachehelichen Unterhalt.
Kann ich noch eine Verschuldensscheidung verlangen, wenn ich dem Partner bereits verziehen habe?
Nein. Eine Scheidung wegen Verschuldens ist ausgeschlossen, wenn die Handlungen des anderen Ehegatten vom verletzten Partner ausdrücklich oder stillschweigend verziehen wurden oder das betreffende Verhalten nicht als ehezerstörend bewertet wurde.
Wie lange habe ich Zeit, um einen Verschuldensgrund geltend zu machen?
Der Scheidungsgrund muss spätestens sechs Monate, nachdem der betroffene Ehepartner von der Verfehlung Kenntnis erlangt hat, geltend gemacht werden. Handelt es sich um eine fortgesetzte Verfehlung, beginnt diese Frist erst zu laufen, wenn das betreffende Verhalten beendet ist. Unabhängig davon gilt eine absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren, nach deren Ablauf eine Berufung auf diesen Scheidungsgrund nicht mehr zulässig ist.
Welche anderen Gründe als Verschulden führen zur Scheidung?
Zusätzlich zur Verschuldensscheidung sind weitere Scheidungsgründe im Gesetz vorgesehen:
- Einvernehmliche Scheidung: Wenn die Ehegatten sich einig sind, können sie einen gemeinsamen Scheidungsantrag stellen, vorausgesetzt die eheliche Gemeinschaft ist seit mindestens einem halben Jahr aufgehoben, beide Partner erkennen die unheilbare Zerrüttung an und legen eine schriftliche Vereinbarung über Unterhalt und Vermögensaufteilung sowie gegebenenfalls über Obsorge und Kontaktrecht minderjähriger Kinder vor.
- Auflösung der häuslichen Gemeinschaft: Ist die eheliche Lebensgemeinschaft mindestens drei Jahre lang aufgehoben und gilt die Ehe als unheilbar zerrüttet, kann jeder Ehegatte die Scheidung verlangen. Es spielt keine Rolle, von wem die Zerrüttung ausgeht oder wer daran schuld ist. Allerdings darf die Scheidung verweigert werden, wenn das Gericht eine Wiederherstellung der Lebensgemeinschaft für möglich hält oder die Härteklausel greift. Nach sechs Jahren der Trennung muss der Scheidungsantrag jedoch üblicherweise stattgegeben werden.
- Krankheitsbedingte Scheidung: Wenn ein Ehegatte aufgrund einer psychischen Krankheit oder vergleichbaren Beeinträchtigung ein Verhalten zeigt, das einer schweren Eheverfehlung gleichkommt, jedoch nicht schuldhaft ist und dadurch die Ehe unheilbar zerrüttet wird. Auch das Vorliegen einer ansteckenden oder ekelerregenden Krankheit kann einen Scheidungsgrund darstellen, sofern keine Heilung oder Beseitigung der Ansteckungsgefahr in absehbarer Zeit zu erwarten ist. Hier gilt jedoch die Härteklausel: Die Scheidung ist unzulässig, wenn sie sittlich nicht vertretbar wäre, etwa bei außergewöhnlicher Härte für den erkrankten Partner.
Wie regelt sich der Unterhalt nach der Scheidung?
Grundsätzlich endet der während der Ehe bestehende Unterhaltsanspruch mit Rechtskraft der Scheidung. In bestimmten Fällen kann allerdings ein Anspruch auf nachehelichen Unterhalt bestehen bleiben. Die Ehepartner können dies einvernehmlich regeln. Kommt jedoch keine einvernehmliche Lösung zustande, entscheidet das Gericht anhand der Scheidungsart sowie der Frage, wer die Hauptschuld an der Zerrüttung trägt.
Wie wird der Unterhalt bei einer Verschuldensscheidung geregelt?
Bei einer Scheidung wegen Verschuldens ist der überwiegend schuldige Ehepartner zur Zahlung eines angemessenen Unterhalts verpflichtet, sofern das Einkommen des anderen nicht ausreicht. Dieser Unterhaltsberechtigte muss jedoch einer zumutbaren Erwerbstätigkeit nachgehen, sofern dies möglich ist. In Fällen, in denen dies nicht oder nur eingeschränkt möglich ist, kann ein verminderter Unterhaltsanspruch aus Billigkeitsgründen zugesprochen werden.
Sind beide Ehepartner gleichermaßen schuld, besteht in der Regel kein voller Unterhaltsanspruch. Allerdings kann aus Gründen der Billigkeit dennoch ein reduzierter Beitrag gewährt werden, sofern der betreffende Ehegatte sich nicht aus eigener Kraft unterhalten kann. Unabhängig vom Verschulden existieren zwei Sonderregelungen, in denen Unterhalt gefordert werden kann:
- Betreuungsunterhalt
- Wenn aufgrund von Pflege und Erziehung eines gemeinsamen Kindes eine eigenständige Berufstätigkeit nicht möglich ist (insbesondere bis zum fünften Lebensjahr des Kindes).
- Unterhalt wegen ehebedingter Einschränkung der Erwerbsfähigkeit
- Wurde in der Ehe überwiegend Haushalt geführt und Kinder betreut, so kann auch nach der Scheidung Unterhalt beansprucht werden, solange eine eigenständige Existenzsicherung nicht zumutbar ist.
Was gilt beim Unterhalt, wenn im Scheidungsurteil kein Verschulden festgestellt wird?
Bei Scheidungen, die nicht auf Verschulden beruhen, hängt die Unterhaltspflicht davon ab, ob ein Schuldausspruch im Urteil enthalten ist. Fehlt dieser, kann derjenige, der die Scheidung verlangt hat, nach Billigkeit zur Unterhaltsleistung verpflichtet werden.
Liegt hingegen ein Schuldausspruch vor – etwa bei einer Scheidung wegen Auflösung der häuslichen Gemeinschaft oder aus Krankheitsgründen –, gelten im Wesentlichen ähnliche Bestimmungen wie bei einer Verschuldensscheidung. So wird der Unterhaltsanspruch zum Beispiel nach denselben Maßstäben wie bei einer aufrechten Ehe berechnet, um den schutzbedürftigen Ehepartner abzusichern.
Wie wird das eheliche Vermögen nach der Scheidung aufgeteilt?
Während der Ehe gilt – sofern nicht anders vereinbart – das Prinzip der Gütertrennung, wonach jeder Ehegatte sein eigenes Vermögen behält. Nach der rechtskräftigen Scheidung greift jedoch die Regelung der ehelichen Güterteilhabe. Innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der Scheidung können beide Ehepartner, falls keine gütliche Einigung erzielt wird, die Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der gemeinsam angesparten Ersparnisse verlangen.
Kann man von der gesetzlich vorgeschriebenen Vermögensaufteilung abweichen?
Ja. Die Ehepartner können eine einvernehmliche Aufteilungsvereinbarung treffen, die das Gericht bei einer Scheidung bindet, sofern keine unzumutbare Benachteiligung eines Ehegatten vorliegt. So darf das Gericht nur dann eingreifen, wenn eine Partei durch die Vereinbarung erheblich benachteiligt würde. Oft wird auch schon vor der Ehe ein Ehevertrag abgeschlossen, um Regelungen zu finanziellen Angelegenheiten – etwa im Zusammenhang mit Immobilien – individuell festzulegen.
Welche Besitztümer und Rücklagen werden bei einer Scheidung üblicherweise aufgeteilt?
Zur Aufteilung kommen grundsätzlich das eheliche Gebrauchsvermögen und die während der Ehe gebildeten Ersparnisse. Als eheliches Gebrauchsvermögen gelten jene Gegenstände, die beide Ehegatten im Alltag genutzt haben, darunter fällt in vielen Fällen auch die Ehewohnung. Vermögensgegenstände, die vor der Ehe eingebracht oder erst nach Auflösung der ehelichen Lebensgemeinschaft erworben wurden, sowie Schenkungen oder Erbschaften von Dritten bleiben außerhalb der Aufteilung. Unternehmen oder Unternehmensanteile sind ebenfalls nicht betroffen. Eine Ausnahme kann allerdings für die Ehewohnung gelten, wenn ein Ehepartner sie dringend zur Sicherung seiner Lebensführung benötigt oder wenn das Kindeswohl dies erfordert.
Welche Fristen gelten für die Aufteilung des ehelichen Vermögens?
Wer eine Aufteilung des ehelichen Vermögens beanspruchen möchte, muss dies innerhalb eines Jahres nach der rechtskräftigen Scheidung oder nach Nichtigerklärung der Ehe tun, sofern keine einvernehmliche Regelung getroffen wurde. Nach Ablauf dieser Frist erlischt der Anspruch.
Quellen
- Rechtsinformationssystem (RIS) des Bundes – Gesetzestexte zum österreichischen Scheidungsrecht (insb. Ehegesetz und Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch), aktuelle konsolidierte Fassungen.
- Österreichisches Bundesportal oesterreich.gv.at – Offizielle Informationen der Republik Österreich (Bundesministerium für Justiz und weitere Stellen).
- Informationsbroschüren und Leitfäden (Bundesministerium für Justiz) – z. B. „Leitfaden Scheidung“ und Merkblätter zu Obsorge und Unterhalt.
Das sagen unsere Klienten
Mehr Rezensionen finden Sie auf unserem Google Profil
Kontaktieren Sie uns
Sie können uns telefonisch, per E-Mail oder per Kontaktformular erreichen.
Kanzlei IBESICH
Josefstädter Straße 11/1/16
1080 Wien
MO-FR: 9:00 – 18:00 Uhr
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Google Maps. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenInsights aus der Kanzlei IBESICH
News aus der Kanzlei und rechtliche Updates in Österreich.