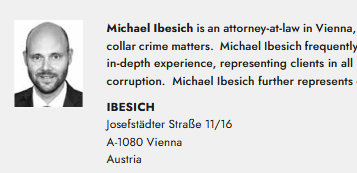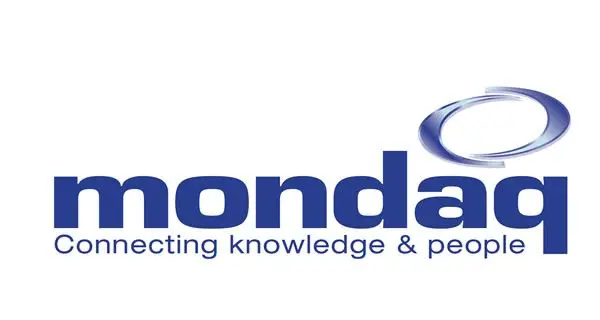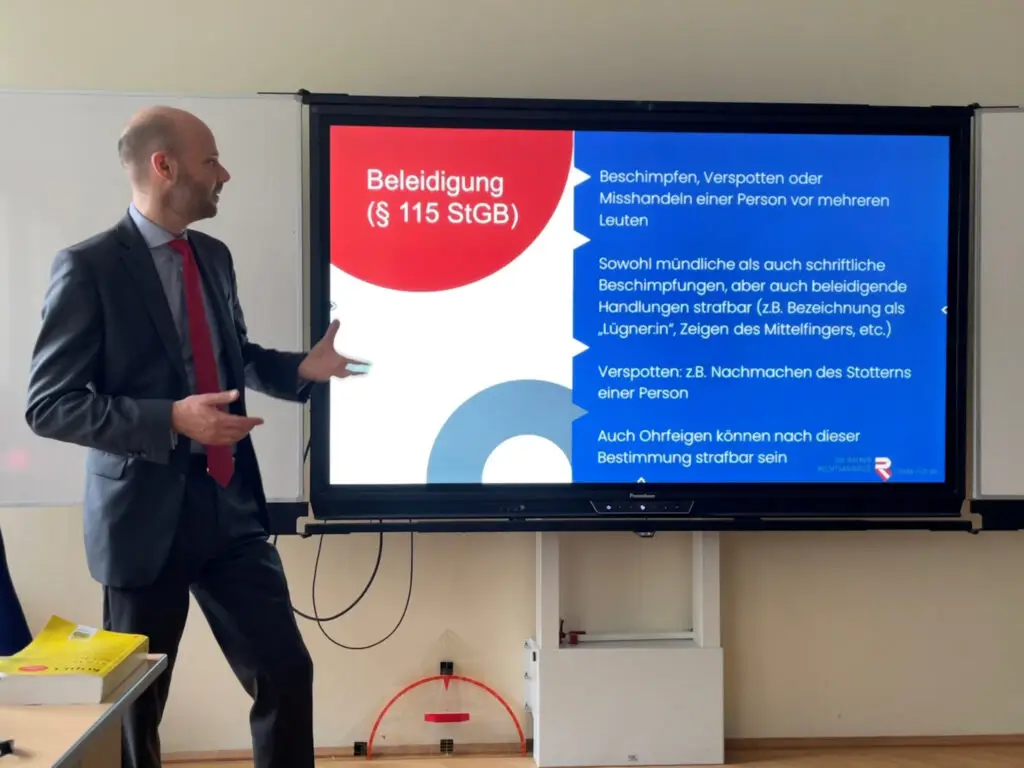Vermögensaufteilung bei der Scheidung

Rechtsanwalt, spezialisiert auf Familienrecht & Scheidungen, Inhaber der Kanzlei IBESICH
Rechtlicher Hinweis/Disclaimer: Die folgenden Informationen dienen einer ersten Orientierung und ersetzen keine individuelle Rechtsberatung. Bitte wenden Sie sich für eine auf Ihren Einzelfall zugeschnittene Beratung an einen Rechtsanwalt oder eine andere qualifizierte Beratungsstelle.
Eine Scheidung ist nicht nur emotional belastend, sondern hat auch erhebliche finanzielle Folgen. Einer der wichtigsten Aspekte ist die Vermögensaufteilung, also die gerechte Aufteilung des gemeinsamen Vermögens der Ehepartner.
In Österreich gilt während der Ehe grundsätzlich Gütertrennung – jeder bleibt Eigentümer seines eingebrachten oder während der Ehe erworbenen Vermögens.
Kommt es jedoch zur Scheidung, wird das eheliche Gebrauchsvermögen und das eheliche Ersparte nach gesetzlichen Regeln zwischen den Ehegatten aufgeteilt. Ziel ist eine faire Lösung, die beiden Ex-Partnern einen finanziell abgesicherten Neustart ermöglicht. Dieser Ratgeber erklärt leicht verständlich, was bei der Vermögensaufteilung nach österreichischem Recht zu beachten ist und wie Sie Streitigkeiten vermeiden können.
Das Wichtigste in Kürze
Aufteilungsmasse:
Alles, was während der Ehe für die gemeinsame Lebensführung erworben oder erspart wurde.
Ausnahmen:
- Voreheliches Eigentum
- unentgeltliche Zuwendungen (Erbschaften / Schenkungen),
- rein persönliche Gegenstände
- Berufs- und Firmeneigentum (sofern kein bloßes Investment)
Möglichkeiten:
- Einvernehmlich
- Gerichtlich
Stichtage:
- Beginn = Tag der Eheschließung
- Ende = Aufhebung der Lebensgemeinschaft (Trennung)
- Antrag max. 1 Jahr nach Scheidung (gerichtliche Lösung)
Typische Streitpunkte:
- Ehewohnung / Haus
- Spar- & Depotguthaben
- Fahrzeuge
- Versicherungen
Inhaltsverzeichnis
Rechtsgrundlagen
Die rechtliche Basis für die Vermögensaufteilung bildet in Österreich vor allem das Ehegesetz. Dort sind die Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der Ersparnisse, die Ausnahmen sowie die Kriterien der Aufteilung geregelt.
Wichtig ist der Grundsatz der Billigkeit: Das Vermögen soll nach der Scheidung möglichst gerecht zwischen den Ex-Partnern verteilt werden. Dabei kommt es nicht auf ein Verschulden am Scheitern der Ehe an. Stattdessen wird besonders darauf geachtet, welchen Beitrag jeder Ehegatte zur Anschaffung des gemeinsamen Haushaltsguts und zur Bildung der Ersparnisse geleistet hat und welche Bedürfnisse etwaige gemeinsame Kinder haben.
Spezielle Bestimmungen regeln außerdem, dass nach der Ehe die Lebensbereiche der Ex-Partner soweit wie möglich getrennt werden sollen (sogenannter Trennungsgrundsatz) und Eigentumsübertragungen von Immobilien nur erfolgen sollen, wenn keine andere Lösung fair wäre (sogenannter Bewahrungsgrundsatz).
Was fällt unter das eheliche Vermögen?
Definition von ehelichem und vorehelichem Vermögen
Als eheliches Vermögen im Sinne der Aufteilung gilt all jenes Vermögen, das die Eheleute während der aufrechten ehelichen Lebensgemeinschaft erworben haben und das für die gemeinsame Lebensführung bestimmt war. Dazu zählen sowohl gemeinsam angeschaffte Gegenstände des täglichen Lebens (Hausrat, Fahrzeuge, etc.) als auch gemeinsam aufgebaute Ersparnisse und Kapitalanlagen.
Unerheblich ist, wer die finanziellen Mittel dafür aufgebracht hat oder auf wessen Namen etwas läuft – sobald die Sache für beide Ehepartner bestimmt war, zählt sie zum ehelichen Gebrauchsvermögen oder zu den ehelichen Ersparnissen.
Voreheliches Vermögen hingegen umfasst alle Vermögenswerte, die ein Ehepartner bereits vor der Eheschließung besessen hat. Solche vor der Ehe erworbenen Güter bleiben im Scheidungsfall in aller Regel bei demjenigen Ehegatten, der sie eingebracht hat, und unterliegen nicht der Aufteilung.
Beispiel: Hatte die Ehefrau vor der Hochzeit eine Eigentumswohnung gekauft und bleibt diese Wohnung während der Ehe allein in ihrem Besitz und wurde nicht gemeinsam genutzt, so fällt sie nicht in die Aufteilungsmasse. Allerdings muss man aufpassen: Wurde das voreheliche Gut in der Ehe gemeinsam genutzt oder flossen gemeinsame Investitionen hinein, kann zumindest der Wertzuwachs sehr wohl relevant werden.
Zusammengefasst fällt unter das aufzuteilende eheliche Vermögen alles, was die Partner zwischen Eheschließung und Trennung gemeinsam erwirtschaftet, angeschafft oder angespart haben. Nicht dazu gehören jene Güter, die eindeutig persönliches Eigentum eines Partners geblieben sind und nie Teil der gemeinsamen Wirtschaftsführung waren.
Schenkungen und Erbschaften
Geld oder Sachen, die ein Ehegatte während der Ehe geschenkt bekommt oder erbt, stellen eine Sonderkategorie dar und sind von der Aufteilung ausgenommen.
Das heißt, wenn z. B. der Ehemann während der Ehe von seinen Eltern einen größeren Geldbetrag geschenkt bekommt oder die Ehefrau von einer Tante ein Grundstück erbt, dann bleibt dieses Vermögen im Scheidungsfall dem jeweiligen Empfänger vorbehalten. Der andere Partner hat darauf keinen direkten Anspruch.
Wichtig: Diese Ausnahme gilt nur, solange nichts anderes zwischen den Ehegatten vereinbart wurde. Theoretisch könnten die Partner also in einem Ehevertrag festlegen, auch Erbschaften oder Schenkungen zu teilen – dies ist aber unüblich. In der Praxis wird eine Erbschaft/Schenkung meist auf einem getrennten Konto gehalten oder klar dokumentiert, um im Scheidungsfall nachweisen zu können, dass dieser Betrag nicht aus gemeinsamem Erwirtschaften stammt.
Wenn z. B. eine Erbschaft sofort in gemeinsame Anschaffungen gesteckt wurde (etwa das geerbte Geld zur Renovierung des Familienheims verwendet), kann es komplizierter werden: Dann fließt der Wert ggf. doch indirekt in die Aufteilungsrechnung ein, weil er in einem ehelichen Vermögensgegenstand „aufgegangen“ ist. Im Grundsatz jedoch gilt: Was ein Ex-Partner aus fremder Hand unentgeltlich erhalten hat, muss er dem anderen nicht abgeben.
Ebenfalls ausgenommen von der Aufteilung sind laut Gesetz jene Gegenstände, die von einem Ehegatten für seinen persönlichen Gebrauch bestimmt sind, sowie seine Berufsausstattung. Das schließt z. B. Kleidung, Schmuck, persönliche Sammlungen oder Hobbyausrüstung ein, die nur einer alleine genutzt hat, sowie Werkzeuge, Computer oder Fachliteratur, die jemand für seinen Beruf braucht. Solche Dinge verbleiben bei dem jeweiligen Eigentümer und werden nicht geteilt, selbst wenn sie während der Ehe angeschafft wurden.
Unternehmensbeteiligungen
Besitzt einer der Ehegatten ein Unternehmen oder Unternehmensanteile, stellt sich oft die Frage, ob dies Teil der Vermögensaufteilung ist. Gegenstände, die zu einem Unternehmen gehören und auch Anteile an einem Unternehmen von der Aufteilung ausgenommen – es sei denn, es handelt sich um bloße Wertanlagen.
Das bedeutet: Führt z. B. der Ehemann einen eigenen Betrieb, so wird dieser Betrieb als solcher nicht auseinandergeschnitten. Auch Firmenanteile (etwa GmbH-Anteile), die ein Ehegatte hält, bleiben grundsätzlich unberührt, wenn der Ehegatte aktiv im Unternehmen ist.
Anders kann es sein, wenn Unternehmensanteile eigentlich nur als Kapitalanlage gehalten wurden (z. B. Wertpapiere, Aktienpakete), oder wenn eheliches Geld in das Unternehmen investiert wurde. Dient eine Beteiligung bloß der Vermögensanlage, zählt sie zu den ehelichen Ersparnissen und wäre aufzuteilen. In der Praxis wird man hier genau hinsehen: War der Ehepartner in der Firma tätig, greift der Schutz des § 82; war es nur eine stille Beteiligung zur Geldanlage, muss der Wert ggf. geteilt werden.
Wichtig ist zudem: Auch wenn das Unternehmen selbst nicht geteilt wird, kann der andere Ehepartner unter Umständen einen Ausgleich verlangen, wenn eheliche Mittel maßgeblich zum Wert des Unternehmens beigetragen haben. Das Gericht kann dann z. B. entscheiden, dass der unternehmerisch tätige Partner dem anderen eine Abfindung zahlt, anstatt diesem einen Anteil am Betrieb zu übertragen. Damit soll verhindert werden, dass eine Firma durch die Scheidung zerschlagen wird, aber dennoch der Beitrag des anderen honoriert wird.
Schulden
Zu einer vollständigen Vermögensaufstellung gehören auch die Schulden der Ehepartner. Nicht selten bestehen gemeinsame Kredite (etwa für Haus, Auto) oder Schulden, die im Interesse der Familie aufgenommen wurden. Grundsätzlich gilt: Schulden, die in engem Zusammenhang mit dem ehelichen Lebensaufwand oder dem angeschafften Vermögen stehen, werden bei der Aufteilung entsprechend berücksichtigt. Man ermittelt also die Nettowerte der Vermögensgegenstände (Marktwert minus offener Kredit).
Ein Beispiel: Wurde ein gemeinsames Auto auf Kredit gekauft, so wird im Scheidungsfall geschaut, was das Auto aktuell wert ist und wie viel Kredit noch offen ist. Nur der Wertüberschuss wird als Vermögen aufgeteilt; die restliche Kreditschuld wird den Parteien anteilig „zugerechnet“ bzw. vom Fahrzeugwert abgezogen. Ähnlich bei Immobilien mit Hypothek.
Schulden, die nicht im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Haushalt oder Vermögen stehen – zum Beispiel ein Privatkredit eines Ehegatten für ein rein persönliches Hobby oder Altschulden aus der Zeit vor der Ehe – verbleiben grundsätzlich bei demjenigen, der die Schuld eingegangen ist.
Solche persönlichen Schulden werden bei der Vermögensaufteilung nicht geteilt. Das bedeutet, dass keiner für die privaten Verbindlichkeiten des anderen nach der Scheidung aufkommen muss (ausgenommen natürlich, man hat gemeinsam als Gesamtschuldner unterschrieben).
Wichtig zu beachten: Für Gläubiger gelten weiterhin die ursprünglichen Kreditverträge. Die interne Aufteilung von Schulden zwischen den Ex-Ehegatten ändert nichts daran, wer gegenüber der Bank haftet. Daher müssen sich die geschiedenen Partner oft separat einigen (oder gerichtlich festlegen lassen), wer künftig die Raten zahlt oder ob ein Kredit umgeschuldet wird. Die gerichtliche Vermögensaufteilung kann festlegen, dass einer der Ex-Partner eine Schuld allein übernimmt und den anderen dafür schad- und klaglos hält. Dennoch hat die Bank das Recht, beide in die Pflicht zu nehmen, solange beide unterschrieben haben.

Zeitpunkt der Vermögensaufteilung
Trennung vs. Scheidungszeitpunkt
Entscheidend für die Frage, welches Vermögen aufgeteilt wird, ist der Zeitpunkt der Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft – vereinfacht gesagt: der Zeitpunkt der Trennung. In vielen Ehen fällt die Trennung und die rechtliche Scheidung zeitlich auseinander. Das Gesetz stellt darauf ab, welches eheliche Gebrauchsvermögen und welche Ersparnisse zum Zeitpunkt der Auflösung der ehelichen Gemeinschaft vorhanden waren.
Praktisch bedeutet das: Neues Vermögen, das erst nach der Trennung von „Tisch und Bett“ erworben wurde, zählt nicht mehr zur Aufteilungsmasse. Umgekehrt wird das bis zur Trennung gemeinsam Geschaffene berücksichtigt, selbst wenn die Scheidung erst Monate oder Jahre später rechtskräftig wird.
Die Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft ist jener Zeitpunkt, an dem zumindest ein Ehepartner die gemeinsame Haushalts- und Lebensführung endgültig beendet hat (z. B. Auszug eines Partners aus der Ehewohnung oder anderweitige klare Trennung). Dieser Trennungszeitpunkt ist für die Vermögensaufteilung als Stichtag bedeutsam. Ab diesem Zeitpunkt werden in der Regel keine weiteren Vermögensmehrungen mehr als „gemeinsam“ betrachtet.
Ein Beispiel: Die Eheleute trennen sich im Jänner, leben ab dann getrennt, und im Juli des selben Jahres wird die Scheidung rechtskräftig. Alles, was bis Jänner an Vermögen da war oder bis dahin gemeinsam erworben wurde, wird aufgeteilt. Kauft ein Partner nach der Trennung noch ein neues Auto oder spart aus seinem nun eigenen Einkommen weiteres Geld an, fällt das nicht mehr in die gemeinsame Masse.
Zu beachten ist, dass keine der Parteien zwischen Trennung und Scheidung das eheliche Vermögen unrechtmäßig schmälert. Wer nach der Trennung noch gemeinsame Ersparnisse „verschwinden“ lässt oder Vermögenswerte verbraucht, muss damit rechnen, dass das Gericht diese dennoch so behandelt, als wären sie noch da. § 91 EheG bestimmt nämlich, dass vereiteltes oder verschleudertes Vermögen mitgerechnet werden kann, wenn ein Ehegatte das gemeinsame Vermögen absichtlich verringert hat – insbesondere durch ungewöhnliche Investitionen, die den ehelichen Lebensverhältnissen widersprechen und in den letzten zwei Jahren vor der Trennung vorgenommen wurden. Diese Bestimmung verhindert, dass jemand kurz vor der Scheidung z. B. große Geldbeträge ohne Zustimmung des Partners ausgibt, um weniger teilen zu müssen.
Stichtage laut Gesetz
Im Ergebnis gibt es also zwei wichtige Zeitpunkte (Stichtage) für den Vermögensausgleich:
- Beginnstichtag: der Tag der Eheschließung. Vermögenszuwächse werden erst ab Eheschließung relevant; alles davor bleibt außen vor (als eingebrachtes Vermögen).
- Endstichtag: der Zeitpunkt der Aufhebung der ehelichen Lebensgemeinschaft (Trennung). Bis dahin erwirtschaftetes Vermögen ist aufzuteilen, danach erwirtschaftetes nicht mehr.
Für die Bewertung mancher Vermögensgegenstände kann noch ein dritter Zeitpunkt ins Spiel kommen, nämlich der Wert zum Zeitpunkt der gerichtlichen Entscheidung. Das Gericht nimmt bei der Entscheidung über die Aufteilung in der Regel den aktuellen Wert der Vermögensobjekte an (d. h. zum Zeitpunkt des Urteils bzw. Beschlusses erster Instanz). Wertsteigerungen zwischen Trennung und Entscheidung werden berücksichtigt, soweit sie ohne Zutun eines Ehegatten entstanden sind (z. B. allgemeine Wertzuwächse von Immobilien). Hat allerdings einer der Ehegatten nach der Trennung den Wert eines Gegenstands durch eigene Leistungen erhöht (z. B. Renovation eines Hauses in Alleinregie), kann das entsprechend bei der Verteilung beachtet werden, damit dieser Mehrwert nicht unverdient dem anderen zugutekommt.
Zusammengefasst: Der Zeitraum vom Ehestart bis zur Trennung bestimmt, was zur gemeinsamen Errungenschaft zählt. Die Vermögensaufteilung erfolgt dann für diesen Zeitraum, wobei die konkrete Bewertung meist zum Zeitpunkt der Scheidung bzw. Gerichtsentscheidung erfolgt. Trennungshandlungen wie der Auszug markieren also die Grenze, ab wann kein weiteres „gemeinschaftliches“ Vermögen mehr entsteht.

Möglichkeiten der Vermögensaufteilung
Einvernehmliche Lösung
Der beste Weg, die Vermögensaufteilung zu regeln, ist eine einvernehmliche Vereinbarung der Ehepartner. Im Rahmen einer einvernehmlichen Scheidung müssen die Eheleute sogar zwingend eine umfassende Scheidungsvereinbarung vorlegen, in der unter anderem die Aufteilung des Vermögens und der Schulden bereits festgelegt ist. Diese sogenannte Scheidungsfolgenvereinbarung enthält also idealerweise schon eine klare Regelung, wer welches Vermögen erhält und wer welche Schulden übernimmt. Die Ehepartner haben hier Gestaltungsspielraum: Sie können eine für beide passende Aufteilung wählen, auch wenn diese vielleicht von der gesetzlichen 50/50-Norm abweicht.
Eine gütliche Einigung hat mehrere Vorteile: Sie schont die Nerven, spart Zeit und Kosten und führt meist zu einem Ergebnis, mit dem beide besser leben können, als wenn ein Gericht entscheidet. Die Partner kennen ihre Vermögensverhältnisse am besten und können kreative Lösungen finden (z. B. Tausch von Vermögenswerten oder Ratenzahlungen für eine Ausgleichszahlung).
Eine derartige Vereinbarung muss rechtsgültig abgeschlossen werden. In Österreich müssen Vereinbarungen über die Aufteilung der ehelichen Ersparnisse oder der Ehewohnung in Form eines Notariatsakts erfolgen. Für anderes Gebrauchsvermögen reicht zwar grundsätzlich Schriftform, aber es empfiehlt sich ebenfalls, wichtige Vereinbarungen notariell zu beurkunden, um ihre Gültigkeit abzusichern.
Das Notariatsakt-Erfordernis betrifft insbesondere Immobilien: Wenn z. B. vereinbart wird, dass der Ehemann die Ehewohnung erhält und die Ehefrau dafür eine Abfindung, muss diese Übereinkunft notariell beglaubigt sein, damit Grundbuchsänderungen vorgenommen werden können. Auch beim Aufteilen größerer Sparguthaben ist ein Notariatsakt notwendig. Kleinere Posten (Möbel, Auto etc.) kann man im Prinzip formloser aufteilen, doch empfiehlt sich auch hier eine klare schriftliche Vereinbarung, um Missverständnisse zu vermeiden.
Beachten Sie, dass eine einvernehmliche Lösung auch während einer Gerichtsverhandlung möglich ist. In diesem Fall ist kein Notariatsakt erforderlich.
Die einvernehmliche Lösung kann auch mithilfe von Anwälten oder Mediatoren erarbeitet werden. Wichtig ist, alle Vermögenswerte und Schulden vollständig offenzulegen und fair zu bewerten. Ist eine Einigung erzielt, wird sie schriftlich festgehalten. Im Zuge der einvernehmlichen Scheidung wird diese Vereinbarung dann vom Gericht genehmigt, was ihr zusätzliche Verbindlichkeit verleiht. Danach können etwaige Umschreibungen (z. B. Übertragung von Liegenschaften) veranlasst werden.
Gerichtliche Entscheidung
Gelingt keine Einigung, bleibt die gerichtliche Vermögensaufteilung. Diese erfolgt auf Antrag nach rechtskräftiger Scheidung – man spricht vom Aufteilungsverfahren. Hierbei entscheidet der Richter oder die Richterin, wie das Vermögen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu verteilen ist. Beide Ex-Partner müssen dazu ihr gesamtes eheliches Vermögen darlegen; oft wird eine detaillierte Aufstellung aller Vermögensgegenstände und Schulden verlangt.
Das Gericht prüft dann, was in die Aufteilungsmasse fällt und was nicht, und nimmt eine Bewertung der einzelnen Posten vor. Schließlich wird unter Abwägung der Beiträge und Umstände (siehe dazu die Aufteilungsfaktoren) ein Aufteilungsschlüssel festgelegt, meist in Prozent oder konkreten Zuteilungen.
In der Praxis bedeutet eine gerichtliche Entscheidung häufig, dass Quoten oder Ausgleichszahlungen festgelegt werden: Beispielsweise kann das Urteil bestimmen, dass jeder Ehepartner die Hälfte des gemeinsamen Sparguthabens erhält, das Auto beim Ehemann verbleibt (der dafür €X Ausgleich an die Ehefrau zahlt) und die Ehewohnung der Ehefrau zugesprochen wird (die den Ehemann mit €Y auszahlt). Das Gericht hat hier einen relativ weiten Ermessensspielraum, um eine „gerechte“ Lösung zu finden. Allerdings ist es an die Leitlinien des Ehegesetzes gebunden (z. B. Berücksichtigung der Kinder, der Beitragsleistung etc.).
Ein gerichtliches Aufteilungsverfahren kann – je nach Komplexität des Vermögens und Streitintensität – ziemlich langwierig und kostspielig sein. Beide Seiten tragen anfangs ihre Anwaltskosten; am Ende kann der obsiegende Teil einen Kostenersatz bekommen, falls einer deutlich unterliegt.
Häufig werden in so einem Verfahren Gutachter hinzugezogen (etwa für Immobilienbewertungen). Das Verfahren ist weniger formal als ein Zivilprozess, aber dennoch gilt es, Beweise zu führen (z. B. über Beiträge oder Herkunft von Vermögenswerten). Die Beweislast dafür, ob etwas in die Aufteilung gehört oder ausgenommen ist, liegt oft bei dem, der eine Ausnahme beansprucht. Beispielsweise müsste der Ehemann beweisen, dass Geld X auf seinem Konto eine Schenkung seiner Eltern war, wenn er das ausnehmen will.
Hinweis: In vielen Fällen ist eine außergerichtliche Einigung zu Beginn nicht möglich, weshalb zunächst eine gerichtliche Entscheidung angestrebt wird. Dennoch kann jederzeit auch eine einvernehmliche Einigung erzielt werden – in der Praxis ist das häufig der Fall. Dadurch lassen sich insbesondere die oft hohen Kosten für Sachverständigengutachten vermeiden. Solche gerichtlichen Vergleiche bedürfen keiner notariellen Beglaubigung.
Achtung: Ein Antrag auf gerichtliche Aufteilung muss innerhalb von einem Jahr nach der Scheidung gestellt werden. Verpasst man diese Frist oder verzichtet ausdrücklich auf die Aufteilung, behält jeder das, was er zu diesem Zeitpunkt hat. Daher sollte man, wenn eine Einigung nicht möglich ist, rechtzeitig den gerichtlichen Weg beschreiten, um Ansprüche zu sichern.
Mediation als Alternative
Zwischen der privaten Einigung und dem harten Gerichtsverfahren steht die Möglichkeit der Mediation. Eine Mediation ist ein freiwilliges Verfahren, bei dem ein neutraler Mediator (oft ein speziell ausgebildeter Rechtsanwalt oder Psychologe) dem Ehepaar hilft, eine einvernehmliche Lösung in Streitfragen – wie der Vermögensaufteilung – zu finden. Mediationsgespräche finden in einem geschützten Rahmen statt und der Mediator unterstützt dabei, dass beide Seiten ihre Interessen offenlegen und konstruktiv verhandeln.
Der große Vorteil der Mediation ist, dass Lösungen erarbeitet werden können, die auf die individuelle Situation zugeschnitten sind und mit denen beide Parteien am Ende leben können. Gerade bei finanziellen Fragen können kreative Kompromisse gefunden werden (z. B. der eine bekommt mehr vom Barvermögen, der andere dafür den gesamten Hausrat, etc.). Mediation kann auch helfen, verhärtete Fronten zu entspannen und Kommunikation zu ermöglichen, was besonders wichtig ist, wenn die Ex-Partner etwa wegen gemeinsamer Kinder weiterhin in Kontakt bleiben müssen.
In Österreich ist Mediation keine Pflicht, wird aber von Gerichten und Beratungsstellen oft empfohlen. Im Scheidungsverfahren selbst weist der Richter zu Beginn häufig auf die Möglichkeit der Mediation hin. Sollte also absehbar sein, dass die Vermögensfrage strittig wird, kann es sinnvoll sein, frühzeitig einen Mediator einzuschalten. Die Kosten einer Mediation tragen die Parteien meist selbst, oft werden sie halbe-halbe geteilt. Diese Kosten sind in vielen Fällen deutlich geringer als ein jahrelanger Rechtsstreit.
Kommt in der Mediation eine Einigung zustande, so wird diese schriftlich fixiert. Anschließend kann man – mit juristischer Unterstützung – daraus eine verbindliche Scheidungsvereinbarung machen (die z. B. notariell beurkundet wird). Die Mediation kann also den Weg zur einvernehmlichen Scheidung ebnen, auch wenn man anfangs weit voneinander entfernt schien. Gelingt keine Einigung, kann man immer noch vor Gericht gehen; die während der Mediation gemachten Aussagen sind vertraulich und dürfen im Gerichtsverfahren nicht gegen eine Partei verwendet werden. Es besteht also kein Risiko, Offenheit in der Mediation „bereut“ sich später vor Gericht.
Wichtige Faktoren bei der Aufteilung
Die gesetzliche Vorgabe der „Aufteilung nach Billigkeit“ bedeutet, dass das Gericht im Streitfall die individuellen Umstände der Ehe berücksichtigen muss. Folgende Faktoren spielen dabei eine wichtige Rolle:
Dauer der Ehe
Wie lange die Ehe gedauert hat, beeinflusst oft die Aufteilung. Allgemein gilt: Je länger die Ehe, desto stärker wird von einem umfassenden wirtschaftlichen Zusammenwirken ausgegangen und desto eher erfolgt eine hälftige Teilung. Bei sehr kurzen Ehen (z. B. nur 1–2 Jahre ohne Kinder) neigen Gerichte dazu, die Vermögensaufteilung sparsam zu handhaben – oft behält dann jeder weitgehend das, was er eingebracht hat, da kaum ein gemeinsamer Aufbau stattfand. Umgekehrt werden bei Ehen, die Jahrzehnte dauerten, alle während dieser Zeit erworbenen Vermögenswerte als gemeinsames Lebenswerk angesehen, unabhängig davon, wer formal Eigentümer ist. Entsprechend wird hier meist 50:50 aufgeteilt, sofern nicht besondere Gründe dagegensprechen.
Auch mittellange Ehen werden fair nach Dauer beurteilt. Beispielsweise kann bei einer 10-jährigen Ehe die Aufteilung anders ausfallen als bei 30 Jahren, weil man annimmt, dass nach 30 Jahren beide ihr Leben komplett verflochten hatten (auch finanziell). Die Ehedauer ist kein isolierter Rechenfaktor, aber sie bildet den Hintergrund: Eine längere Ehe bietet mehr Gelegenheit, dass beide auf unterschiedliche Weise zum gemeinsamen Wohlstand beigetragen haben, was ausgeglichen werden soll.
Beitrag zur Haushaltsführung und Kindererziehung
Einer der wichtigsten Aufteilungsfaktoren ist der Beitrag jedes Ehegatten zum Erwerb des Vermögens. Dieser Beitrag kann in Geld, in Mitarbeit oder in Leistung im Haushalt und bei der Kinderbetreuung bestehen. Das Gesetz stellt klar, dass z. B. die Führung des gemeinsamen Haushalts, die Erziehung gemeinsamer Kinder und sonstiger ehelicher Beistand genauso als Beitrag zum Vermögenserwerb zu werten sind wie Geldverdienen. Diese sogenannte Haushalts- und Familienarbeit wird also ausdrücklich gleichgestellt.
In der Praxis heißt das: Hat ein Partner während der Ehe hauptsächlich den Haushalt geführt und die Kinder betreut, während der andere Partner arbeiten ging, so wird davon ausgegangen, dass der Wert der Haushaltsführung den Erwerbsbeitrag des anderen mit ermöglicht hat. Ohne die Arbeit des einen hätte der andere nicht so frei Karriere machen und Geld verdienen können. Folglich hat der nicht erwerbstätige Partner ein volles Anrecht auf die Hälfte des gemeinsam geschaffenen Vermögens, obwohl er kein eigenes Einkommen hatte.
Gerade in traditionellen Ehemodellen (z. B. Mann erwerbstätig, Frau kümmert sich um Haus und Kinder) verhindert diese Regelung, dass die Hausfrau finanziell leer ausgeht. Ihr Beitrag wird als gleichwertig anerkannt. Vor Gericht wird daher nicht primär gefragt „Wer hat wie viel verdient?“, sondern „Wer hat welchen Anteil geleistet?“. Und die unsichtbare Arbeit in Küche, Kinderzimmer und Pflege wird dabei ausdrücklich mitbewertet.
Wirtschaftliche Verhältnisse der Ehepartner
Auch die wirtschaftlichen Gesamtsituationen der Ehegatten können Einfluss auf die Aufteilung nehmen. Hier geht es um Fragen wie: Verfügt einer der Partner über erhebliches Eigenvermögen außerhalb der Ehe (z. B. große Erbschaft, die nicht aufzuteilen ist)? Wie ist die Einkommens- und Vermögenslage jedes Einzelnen nach der Scheidung? Das Gesetz will vermeiden, dass einer der Ex-Partner durch die Scheidung in eine unzumutbar schlechte Lage gerät, während der andere weitermacht wie zuvor. Deshalb kann ein Gericht bei krassem Ungleichgewicht zugunsten des schwächeren Partners entscheiden.
Ein Beispiel: Hat die Ehefrau während der Ehe nie gearbeitet und kein eigenes Vermögen, während der Ehemann ein Vielfaches an Gehalt verdient hat und vielleicht noch große nicht aufzuteilende Vermögenswerte besitzt, so könnte das Gericht geneigt sein, im Rahmen des möglichen dem wirtschaftlich schwächeren Teil etwas mehr vom gemeinschaftlichen Kuchen zuzuteilen. Ziel ist laut OGH, eine allzu drastische Verschlechterung der Lebensverhältnisse eines Partners zu verhindern. Natürlich sind die Möglichkeiten begrenzt – das Gericht kann nicht über das eheliche Vermögen hinaus etwas zuteilen. Aber bei der Verteilung der ehelichen Güter kann es z. B. statt genau 50:50 auch mal 60:40 machen, wenn besondere Billigkeitsgründe vorliegen.
Ein weiterer Aspekt ist die zukünftige Erwerbsfähigkeit: Wenn etwa ein Partner krankheitsbedingt oder wegen seines Alters kaum noch etwas verdienen kann, während der andere im besten Karrierealter ist, könnte man das indirekt berücksichtigen, indem man dem Schwächeren einen größeren Anteil vom Vermögen belässt. Allerdings wird dieser Punkt oft eher über nachehelichen Unterhalt gelöst (Unterhaltszahlungen statt ungleiche Vermögensaufteilung), da die Gesetzeslage grundsätzlich von einer Halbteilung ausgeht und nur innerhalb gewisser Bandbreiten Abweichungen zulässt.
Investitionen während der Ehe
Von großer Bedeutung sind auch spezielle Investitionen und Leistungen, die ein Ehegatte während der Ehe in gemeinsames Vermögen gesteckt hat. Zum Beispiel: Ein Partner bringt ein halbfertiges Haus in die Ehe ein, der andere investiert viel Zeit und Geld, um das Haus fertigzustellen und erheblich aufzuwerten. Oder einer der beiden steckt erhebliche Mittel in das vom anderen gegründete Unternehmen. Solche Beiträge, die über den normalen Alltag hinausgehen, werden bei der Aufteilung berücksichtigt.
Das Gesetz sagt zwar nicht explizit „wer mehr investiert hat, bekommt mehr zurück“, aber im Rahmen der Billigkeit fließen diese Umstände ein. Insbesondere Wertsteigerungen von eingebrachtem Vermögen aufgrund der Mithilfe des Partners werden üblicherweise geteilt. Der Oberste Gerichtshof hat etwa entschieden, dass der Wertzuwachs einer Liegenschaft, die ein Ehegatte eingebracht hat, hälftig aufzuteilen ist, wenn beide in gleicher Weise zur Werterhöhung beigetragen haben. Selbst wenn die Immobilie selbst nicht aufzuteilen ist (weil eingebracht), kann der andere Partner also einen Anteil am Zugewinn erhalten.
Konkret: Bringt z. B. die Frau ein Grundstück mit Rohbau in die Ehe ein und der Mann finanziert und baut das Haus fertig, dann bleibt zwar das Grundstück als solches ihr Eigentum, aber der Wert, um den das Haus durch den Ausbau gestiegen ist, wird zwischen beiden geteilt. Dieser Wertanteil kann durch eine Ausgleichszahlung ausgeglichen werden.
Ebenfalls typisch sind Fälle, in denen einer der Partner gemeinsame Ersparnisse verwendet, um das Vermögen des anderen zu mehren (z. B. Tilgung eines Kredits, der auf den anderen läuft). Wurden während der Ehe etwa Schulden des Mannes mit dem Gehalt der Frau getilgt, so ist auch das ein Beitrag zum Vermögensaufbau, der bei der Scheidung ausgeglichen werden sollte. Grundsätzlich gilt: Sämtliche finanzielle oder arbeitsmäßige Inputs in das gemeinsame Projekt Ehe sind zu berücksichtigen – niemand soll am Ende das Gefühl haben, der andere profitiere unverdient von seinen Mühen.

Typische Streitpunkte – Wer bekommt was?
Immobilien (gemeinsames Haus/Wohnung)
Immobilien sind wohl der häufigste Streitpunkt bei Vermögensaufteilungen. Die Frage „Wer bekommt das Haus?“ birgt viel Zündstoff – schließlich geht es um hohe Werte und oft auch um das Zuhause der Familie. Hier einige typische Konstellationen und Lösungen:
Gehört die Immobilie beiden Ehepartnern zu ideellen 1/2 (z. B. gemeinsam im Grundbuch), wird sie in der Regel entweder verkauft und der Erlös geteilt, oder einer behält das Haus und zahlt den anderen aus. Die Auszahlungssumme bemisst sich nach dem aktuellen Wert der Immobilie abzüglich etwaiger Schulden und geteilt nach der vereinbarten Quote (oft 50:50). Häufig möchte einer der Ex-Partner – etwa derjenige, der mit den Kindern wohnen bleibt – das Haus behalten. Dann muss er den anderen finanziell abfinden, entweder durch eine einmalige Ausgleichszahlung oder durch Übernahme gemeinsamer Schulden in entsprechend größerem Anteil.
Ist die Immobilie mit einem Kredit belastet, wird dieser bei der Berechnung berücksichtigt. Beispiel: Das Haus hat einen aktuellen Verkehrswert von €300.000, die offene Kreditschuld beträgt €100.000. Der Nettovermögenswert beträgt somit €200.000. Bei hälftiger Aufteilung stünden jedem €100.000 zu. Wenn nun die Frau das Haus übernimmt, müsste sie dem Mann folglich ~€100.000 als Ausgleich zahlen (ggf. durch Übernahme des Kredits oder in bar). Hat der ausziehende Mann nach der Trennung jedoch noch allein Kreditraten weiterbezahlt, erhöhen diese Zahlungen seinen Anspruch entsprechend. Umgekehrt reduzieren alleinige Kreditraten der im Haus bleibenden Frau nach der Trennung nicht deren Ausgleichszahlung – denn sie kommen ihr in Form von höherer Eigenkapitalbildung im Haus zugute. In der Praxis wird bei solchen Berechnungen also sehr genau geschaut, wer seit wann welche Last getragen hat.
Heikel sind Fälle, in denen ein Haus einem Ehegatten allein gehört (z. B. mit in die Ehe gebracht oder geerbt). Dann fällt es grundsätzlich nicht in die Aufteilung. Doch wenn beide darin gelebt haben, hat der andere oft zumindest ein starkes Interesse an einem Wohnrecht oder an Entschädigung. Die Gerichte können in besonderen Fällen dem nicht-eigentumsberechtigten Partner ein zeitlich befristetes Wohnrecht in der Ehewohnung zusprechen, etwa bis dieser eine neue Bleibe gefunden hat. Insbesondere wenn Kinder im Spiel sind, wird häufig entschieden, dass die Hauptbezugsperson der Kinder mit diesen vorerst in der Ehewohnung bleiben darf – unabhängig davon, wem die Wohnung gehört. Der Eigentümer bekommt dann statt der Wohnung z. B. mehr vom sonstigen Vermögen oder eine Geldentschädigung.
Bei gemeinsamen Krediten für eine Immobilie bleibt beiden bewusst: Die Bank fordert von beiden die Zahlung (sofern beide unterschrieben haben), egal wie intern aufgeteilt wird. In der Scheidungsfolgenvereinbarung oder im Gerichtsbeschluss wird daher meist geregelt, dass derjenige, der das Haus übernimmt, auch die alleinige Verpflichtung für den Kredit übernimmt und den anderen aus der Haftung entlässt (soweit die Bank dem zustimmt). Gelingt das nicht, muss man andere Vermögensausgleiche finden. Es ist immer ratsam, die Bank frühzeitig einzubeziehen, wenn z. B. eine Umschuldung oder Übernahme geplant ist.
Ein Spezialfall ist die sogenannte Ehewohnung zur Miete. Wenn ein Paar in einer Mietwohnung lebte, die beide gemeinsam gemietet haben, stellt sich die Frage, wer das Mietrecht fortführt. Nach österreichischem Mietrecht kann bei Scheidung vereinbart oder gerichtlich festgelegt werden, dass ein Ehepartner den Mietvertrag alleine übernimmt. Der andere scheidet dann aus dem Vertrag aus. Hier entscheidet oft das Kindeswohl (bei Kindern) oder die Bedürftigkeit. Der Vermieter muss die Vertragsübernahme akzeptieren, wenn das Gericht sie so beschließt. Derjenige, der auszieht, hat dann keinen Anspruch mehr auf die Wohnung, aber auch keine Pflichten (Mietzahlung) mehr dafür.
Insgesamt erfordert der Bereich Immobilien eine sorgfältige Betrachtung und oft auch Expertengutachten (zur Wertermittlung). Eine faire Lösung zu finden ist wichtig, denn das Zuhause hat großen Einfluss auf die Lebensqualität nach der Scheidung. Daher wird diesem Punkt in Verhandlungen meist viel Raum eingeräumt.
Sparbücher, Wertpapiere, Lebensversicherungen
Auch Geldvermögen wie Bankguthaben, Wertpapierdepots und Versicherungen sind häufig Gegenstand von Streit. Typischerweise geht es um Sparbücher, Investmentfonds, Aktiendepots oder kapitalbildende Lebensversicherungen, die während der Ehe angespart wurden. Solche ehelichen Ersparnisse sind aufzuteilen. In der Regel werden Kontostände zum Stichtag ermittelt und hälftig geteilt, es sei denn, es gibt Gründe für eine andere Quote.
Wichtig ist, dass wirklich alle Konten und Anlagen offengelegt werden. Manchmal kommt es vor, dass ein Partner versucht, noch schnell Geld vom gemeinsamen Konto abzuziehen oder verschwiegene Ersparnisse auf die Seite zu schaffen. Das Gericht kann solche Aktionen durchschauen und – wie oben erwähnt – dennoch so behandeln, als wäre das Geld vorhanden (bis zur Höhe dessen, was der eine dem anderen unzulässigerweise entzogen hat). Transparenz ist also wesentlich, zumal ein schuldhaftes Verheimlichen von Vermögen im Verfahren negative Folgen haben kann.
Wertpapiere und Fonds: Diese werden nach ihrem aktuellen Depotwert aufgeteilt. Bei Aktien muss man oft berücksichtigen, dass Kursschwankungen möglich sind – häufig einigt man sich, entweder das Depot aufzuteilen (jede Aktie hälftig verkaufen und Geld teilen oder Aktien physisch aufteilen) oder einem Partner das gesamte Depot zu geben und den Wert auszuzahlen. Letzteres kann z. B. sinnvoll sein, wenn ein Partner sich besser damit auskennt oder besonders an bestimmten Papieren hängt.
Lebensversicherungen: Kapitalbildende Lebens- oder Rentenversicherungen (mit Rückkaufswert) zählen ebenfalls zu den ehelichen Ersparnissen. Ihr zum Aufteilungsstichtag vorhandener Rückkaufswert wird in die Berechnung einbezogen. Man kann die Police entweder auf einen Partner übertragen und den anderen auszahlen, oder sie auflösen und das Guthaben teilen (wobei aber meist Verluste entstehen, wenn man vorzeitig kündigt). Reine Risikolebensversicherungen ohne Sparanteil haben dagegen keinen relevanten Vermögenswert.
Wenn Kinder da sind, gibt es manchmal auch Sparbücher auf den Namen der Kinder. Hier ist die Rechtslage heikel: Zwar gehören solche Guthaben formal dem Kind, doch oft stammen die Einzahlungen von den Eltern. Wurden diese Sparbücher hauptsächlich zum Vermögensaufbau der Eltern genutzt (sozusagen als „Parkkonto“ fürs eigene Geld), können Gerichte sie dennoch als Teil des ehelichen Vermögens werten. Allerdings ist das ein Ausnahmefall – grundsätzlich bleibt das Vermögen der Kinder außen vor. Nur wenn ein Elternteil behauptet, der andere habe Geld auf die Kinder überwiesen, um es vor der Aufteilung in Sicherheit zu bringen, könnte das relevant werden.
Private Altersvorsorgen: Auch private Pensionsvorsorgeprodukte (etwa private Rentenversicherungen, Pensionskassen oder ähnliches), die während der Ehe angespart wurden, gelten als Wertanlage und somit als eheliche Ersparnisse. Es kann allerdings kompliziert sein, ihren Wert zu ermitteln und aufzuteilen, vor allem wenn sie nicht vorzeitig kündbar sind. Hier gab es auch OGH-Urteile, ob und wann solche Ansprüche aufzuteilen sind. Grundsätzlich wird der bis zur Trennung erworbene Anspruch bewertet – ob in der Aufteilung dann eine entsprechende Ausgleichszahlung fließt oder andere Güter entsprechend verteilt werden, hängt vom Einzelfall ab. Wird eine private Pensionsversicherung beispielsweise bei Scheidung geteilt, könnte man vereinbaren, dass jeder eine eigene Versicherung mit hälftigem Wert bekommt, oder dass der eine dem anderen den hälftigen Rückkaufswert auszahlt. Gesetzlich ist das nicht gesondert geregelt, es fällt unter die allgemeinen Aufteilungsregeln.
Hausrat und Fahrzeuge
Hausrat: Möbel, Geräte, Geschirr, Elektrogeräte und all die Dinge des täglichen Haushalts werden als Teil des ehelichen Gebrauchsvermögens behandelt. In vielen Fällen können sich die Ex-Partner hier relativ unkompliziert einigen, wer was mitnimmt. Man teilt den Hausrat oft nach Zugehörigkeit und Bedarf: Welche Sachen hat wer hauptsächlich genutzt? Was wird künftig von wem gebraucht? Häufig verbleiben die meisten Hausratsgegenstände bei dem Partner, der in der Ehewohnung (mit Kindern) bleibt, da dieser den Haushalt weiterführt. Der andere erhält dann vielleicht einzelne Gegenstände oder einen finanziellen Ausgleich, falls der Hausrat besonders wertvoll ist.
Bei alltäglichen Haushaltsgegenständen ist die Bewertung oft schwierig, da Gebrauchtwaren nur noch geringen Zeitwert haben. Es lohnt meist nicht, um jedes Sofa oder jeden Toaster zu streiten. Gerichte sehen es daher gern, wenn die Parteien das außergerichtlich regeln. Sollte es doch vor Gericht gehen, wird häufig eine Loslösung durchgeführt: Jeder macht eine Liste der Gegenstände, die er unbedingt möchte, und der Rest wird zugelost oder nach billigem Ermessen verteilt. In der Praxis lässt sich Hausrat aber fast immer in Eigenregie aufteilen.
Fahrzeuge: Das Familienauto (oder die Autos, wenn beide eins hatten) ist ebenfalls oft Thema. Gibt es ein Auto, das hauptsächlich von einem genutzt wurde (z. B. der Dienstwagen des Mannes), verbleibt es oft bei diesem, ggf. gegen Ausgleichszahlung an den anderen. Waren es zwei Autos, nimmt jeder seins – wobei man schaut, ob die Werte sehr unterschiedlich sind. Falls ja, könnte ein Wertausgleich nötig sein. Ist nur ein Auto vorhanden und beide brauchen mobil zu sein, wird es knifflig. Lösungen sind etwa, dass der eine das Auto erhält, der andere dafür andere Vermögenswerte oder Bargeld kompensatorisch bekommt, mit dem er sich ein eigenes Fahrzeug anschaffen kann.
Manche Dinge im Haushalt sind emotional umkämpft – etwa Haustiere oder Erinnerungsstücke. Haustiere werden juristisch als Sache behandelt, aber de facto versucht man, eine einvernehmliche Lösung zum Wohle des Tieres zu finden (z. B. bei wem es bleibt und ob der andere Besuchsrechte bekommt). Erinnerungsstücke wie Familienfotos werden heute einfach kopiert, damit beide sie haben können. Insgesamt sind Hausrat und Co. zwar oft Gegenstand von Diskussionen, doch verglichen mit Immobilien oder Geldanlagen geht es hier um geringere materielle Werte, sodass Einigungen leichter fallen.

Vorsorge und Absicherung
Eheverträge / Scheidungsvereinbarungen
Um Unsicherheiten bei einer eventuellen Scheidung vorzubeugen, können Paare im Voraus einen Ehevertrag (Ehepakt) schließen. In Österreich lässt sich darin z. B. vereinbaren, dass bestimmte Vermögenswerte im Scheidungsfall anders aufgeteilt werden als gesetzlich vorgesehen. Beliebt ist etwa die Vereinbarung von Gütertrennung mit Ausschluss der Aufteilung – sprich, man schließt im Ehevertrag aus, dass das während der Ehe Erworbene bei Scheidung geteilt wird, oder man legt fixe Quoten fest. Allerdings muss so ein Vertrag strenge Formvorschriften erfüllen: Er ist nur gültig, wenn er als Notariatsakt abgeschlossen wird, also unter Mitwirkung eines Notars mit gleichzeitiger Anwesenheit beider Partner.
Eheverträge können bereits vor der Heirat (pränuptial) oder jederzeit während der Ehe geschlossen werden. Sie bieten sich vor allem an, wenn ungleiche Vermögensverhältnisse bestehen oder besondere Vermögenswerte geschützt werden sollen (z. B. Familienunternehmen, Immobilien, die seit Generationen in einer Familie sind). Mit einem Ehevertrag kann man z. B. festhalten, dass ein bestimmter Betrieb vom Aufteilungsgesetz ausgenommen sein soll, oder dass im Falle einer Scheidung ein bestimmter Betrag als Abfindung gezahlt wird und ansonsten keine weiteren Ansprüche bestehen.
Neben klassischen Eheverträgen gibt es auch die Möglichkeit einer Scheidungsfolgenvereinbarung zum Zeitpunkt der Trennung. Wenn die Scheidung absehbar ist, können die (noch) Ehepartner eine Vereinbarung treffen, die alle Scheidungsfolgen regelt – Unterhalt, Obsorge, Besuchszeiten und eben auch Vermögensaufteilung. Eine solche Vereinbarung wird meist im Zuge einer einvernehmlichen Scheidung geschlossen. Auch hierfür gelten Formvorschriften: Insbesondere die Vermögensaufteilung (Ersparnisse, Immobilien) muss notariell oder gerichtlich protokolliert werden, damit sie Rechtskraft erlangt.
Wichtig ist, dass Eheverträge und Scheidungsvereinbarungen einer Prüfung auf Sittenwidrigkeit standhalten müssen. Eine völlig einseitige Benachteiligung eines Partners könnte unwirksam sein. Beispielsweise würde ein Ehevertrag, in dem ein Ehegatte auf alle Ansprüche verzichtet und im Scheidungsfall nichts bekäme, im Zweifel nicht halten, wenn er grob unbillig ist. Die Gerichte schauen bei Streit über Eheverträge, ob beide Seiten die Konsequenzen verstanden haben und ob nicht einer unangemessen übervorteilt wurde.
Dennoch: Ein ausgewogener Ehevertrag kann Klarheit schaffen und Streit verhindern. Er sollte idealerweise mit anwaltlicher Beratung erstellt werden. Die Erfahrung zeigt, dass Eheverträge oft in guten Zeiten abgeschlossen werden und dann im Schlechten viel Ärger ersparen können, weil beide wussten, worauf sie sich einlassen.
Was kann im Vorhinein geregelt werden?
Neben der Möglichkeit formeller Eheverträge gibt es auch informellere Wege, sich abzusichern. Zum Beispiel können die Partner im Alltag getrennte Konten führen und größere Anschaffungen klar dokumentieren (wer hat wie viel beigetragen?), um im Falle einer Trennung Argumentationsgrundlagen zu haben. Zwar lässt sich der Zugewinnausgleich nicht vollständig umgehen, aber man kann durch saubere Finanztrennung vieles nachvollziehbarer machen.
Für bestimmte Vermögenswerte kann Vorsorge getroffen werden: Hat etwa einer ein Elternhaus geerbt und möchte es vor Aufteilung schützen, könnte man überlegen, es schon vorab an die nächste Generation weiterzugeben (wobei das wiederum Pflichtteilsthemen berührt und sorgfältig zu bedenken ist). Oder man schließt Versicherungen ab, die im Scheidungsfall Vorteile bringen – obwohl es so etwas wie eine „Scheidungsversicherung“ eigentlich nicht gibt.
Eine weitere Option ist der Abschluss eines Notarialsakts bei Schenkungen innerhalb der Ehe. Beispielsweise überträgt ein Partner dem anderen die Hälfte des Hauses schon während der Ehe (als Schenkung). Im Schenkungsvertrag kann eine Rückforderungsklausel für den Scheidungsfall vereinbart werden – das ist aber komplex und erfordert notarielle Beratung. Hier bewegt man sich auf schwierigem Terrain, weil Schenkungs- und Aufteilungsrecht ineinandergreifen.
Praktischer ist oft, im Trennungsfall frühzeitig eine außergerichtliche Vereinbarung aufzusetzen, selbst wenn die Scheidung noch nicht vollzogen ist. Wenn beide merken, dass die Ehe zu Ende geht, können sie schon vor der offiziellen Scheidung eine Aufteilung durchführen (z. B. Konten trennen, wer behält welches Auto klären etc.). Das kann dann später als Basis für die Scheidungsvereinbarung dienen. Allerdings sollte man hier vorsichtig sein: Alles, was man an Vermögensverschiebungen macht, sollte schriftlich fixiert und fair sein, sonst gibt es eventuell später doch Streit oder einer fühlt sich gedrängt.
Generell lässt sich sagen: Je klarer und frühzeitiger wichtige Punkte geregelt werden, desto geringer das Konfliktpotenzial. Dennoch sind „vorbeugende“ Abmachungen stets mit Bedacht zu gestalten – am besten unter Zuhilfenahme eines Notars oder Anwalts –, damit sie im Ernstfall halten und nicht selbst zum Streitgegenstand werden.
Steuerliche und finanzielle Auswirkungen
Grunderwerbsteuer und Immobilienübertragung
Bei der Übertragung von Immobilien im Zuge der Scheidung stellt sich sofort die Frage nach der Grunderwerbsteuer. Normalerweise löst ja jeder Eigentumsübergang an einer Liegenschaft diese Steuer aus (in der Regel 3,5% vom Wert). Im Familienverband – und dazu zählen auch Übertragungen zwischen geschiedenen Ehegatten im Zusammenhang mit der Scheidung – gibt es jedoch Begünstigungen.
Seit 2016 gilt ein gestaffelter Tarif für unentgeltliche Übertragungen unter nahen Angehörigen: 0,5% für die ersten €250.000, 2% für die nächsten €150.000 und erst darüber hinaus 3,5%. Überträgt also zum Beispiel im Scheidungsvergleich der Mann seinen Hälfteanteil am Haus der Frau, so wird diese Übertragung als „im Familienverband unentgeltlich“ behandelt und es fällt nur die gestaffelte Grunderwerbsteuer an, was meist deutlich geringer ist als 3,5% des vollen Wertes.
Wichtig: Auch wenn ein Partner dem anderen eine Ausgleichszahlung (Abfindung) leistet, um die Immobilie zu übernehmen, bleibt diese Übertragung im Zuge der Aufteilung dennoch begünstigt. Sie wird steuerlich behandelt, als wäre sie unentgeltlich. Das heißt, man zahlt nicht für den vollen Kaufpreis 3,5%, sondern nach dem Familientarif, selbst wenn faktisch Geld fließt. Diese Regelung soll Scheidungspaare entlasten und verhindern, dass die Aufteilung durch Steuerlast erschwert wird.
Neben der Grunderwerbsteuer fällt bei Grundübertragungen auch die Grundbucheintragungsgebühr an (derzeit 1,1% vom Wert). Diese Gebühr muss der neue Eigentümer zahlen. Es gibt hier zwar gewisse Begünstigungen bei land- und forstwirtschaftlichen Übertragungen im Familienverband, aber im allgemeinen urbanen Bereich sind 1,1% zu entrichten.
Man sollte ebenfalls an die Immobilienertragsteuer (ImmoESt) denken: Wenn eine Immobilie verkauft wird (z. B. an Dritte, weil keiner sie übernehmen will), fällt unter Umständen ImmoESt auf den Verkaufsgewinn an. Das betrifft oft das gemeinsame Haus, sofern es nicht zur Gänze Hauptwohnsitz beider war. Wird das Haus hingegen im Zuge der Scheidung von einem an den anderen übertragen, fällt keine ImmoESt an, da ja kein Verkauf an Dritte stattfindet.
Zusammengefasst sind Übertragungen zwischen Ex-Gatten im Zuge der Vermögensaufteilung steuerlich privilegiert, insbesondere durch den reduzierten Grunderwerbsteuersatz. Dennoch sollte man die Formalitäten (Notariatsakt, Eintragungsgebühr etc.) bedenken und idealerweise steuerlichen Rat einholen, wenn größere Vermögenswerte zu übertragen sind.
Auswirkungen auf Unterhalt und Pensionsansprüche
Vermögensaufteilung, Unterhalt und Pension sind drei getrennte Bereiche, doch es gibt Schnittstellen:
Unterhalt: Die Aufteilung des Vermögens kann indirekt den nachehelichen Unterhalt beeinflussen. In Österreich richtet sich Ehegattenunterhalt vor allem nach Verschulden und den Lebensverhältnissen während der Ehe. Wenn aber ein unterhaltsberechtigter Ex-Partner durch die Vermögensaufteilung ausreichend abgesichert ist (z. B. eigenes Haus, Ersparnisse erhalten hat), kann dies die Bedürftigkeit und damit die Unterhaltshöhe reduzieren. Oft werden im Zuge von Scheidungsvergleichen Vermögensaufteilung und Unterhaltsfragen zusammen verhandelt: Beispiel: Die Ehefrau verzichtet auf langjährigen Unterhalt, dafür bekommt sie einen höheren Anteil am Vermögen (eine Art Abfindung). Solche Pakete müssen jedoch fair sein und das Gericht überzeugen, dass keiner unangemessen benachteiligt wird.
Für Kinderunterhalt spielt die Vermögensaufteilung keine direkte Rolle – dieser bemisst sich nach dem Einkommen des Unterhaltspflichtigen. Aber natürlich kann ein großer Vermögensverlust oder -gewinn langfristig auch das Einkommensniveau beeinflussen (z. B. weil man Wohnkosten spart, wenn man das Haus behalten durfte). Im rechtlichen Sinne bleibt der Kindesunterhalt davon aber getrennt. Über unseren Unterhaltsrechner können Sie Richtwerte für Alimente berechnen.
Pensionsansprüche: In Österreich gibt es – anders als etwa in Deutschland – keinen automatischen Pensionssplitting-Mechanismus bei Scheidung. Jeder behält grundsätzlich seine eigenen Ansprüche aus der gesetzlichen Pensionsversicherung. Allerdings gibt es das Instrument des freiwilligen Pensionssplittings für Eltern: Dabei kann ein Partner dem anderen einen Teil seiner Pensionsgutschriften übertragen, wenn Kinder erzogen wurden. Dies muss jedoch während aufrechter Ehe beantragt werden, spätestens bis zum 7. Geburtstag des Kindes. Im Scheidungsfall kann man diese Option also nur rückwirkend nutzen, falls man es davor versäumt hat, geht es nicht mehr.
Für die betriebliche und private Altersvorsorge gilt wiederum: Soweit sie einen Kapitalwert haben, wurden sie in der Vermögensaufteilung berücksichtigt (siehe Lebensversicherungen oben). Dadurch erhält z. B. ein Partner die Hälfte einer privaten Pensionsversicherung ausgezahlt, was seine eigenen Alterseinkünfte später erhöhen kann, während der andere entsprechend weniger hat. Insofern kann die Vermögensaufteilung die Verteilung künftiger Renten beeinflussen.
Ein wichtiger Aspekt ist die Witwen- oder Witwerrente (Witwenpension) für geschiedene Ehepartner. Grundsätzlich haben geschiedene Partner in Österreich Anspruch auf eine Witwenpension, wenn der Verstorbene zum Zeitpunkt des Todes aufgrund eines Gerichtsurteils, Vergleichs oder vertraglich zu Unterhalt verpflichtet war. Auch wenn kein Titel vorliegt, aber der Verstorbene freiwillig mindestens ein Jahr lang regelmäßig Unterhalt geleistet hat und die Ehe mindestens 10 Jahre gedauert hat, besteht ein Anspruch. Das bedeutet: Stirbt der Ex-Gatte und die Ex-Gattin hatte von ihm Unterhalt bekommen, kann sie eine Witwenrente aus der Pensionsversicherung beanspruchen. Diese beträgt – je nach eigenem Einkommen – bis zu 60% der Pension des Verstorbenen. Wenn allerdings im Scheidungsvergleich auf Unterhalt verzichtet wurde (etwa gegen höhere Vermögensaufteilung), kann dies dazu führen, dass kein Witwenpensionsanspruch entsteht, weil keine Unterhaltsverpflichtung bestand. Das sollte bei solchen Vereinbarungen bedacht werden.
Zusammengefasst: Die Vermögensaufteilung und der Unterhalt beeinflussen sich gegenseitig oft indirekt. Eine ausgewogene Gesamtlösung bei Scheidungsvergleichen bezieht beides mit ein. Pensionsrechtlich gibt es kein Splitting ex officio, aber geschiedene, unterhaltsberechtigte Personen sind durch die Möglichkeit einer Witwenpension im Todesfall des Ex geschützt – vorausgesetzt, es gab Unterhaltszahlungen oder -anspruch. Letztlich sollte man sowohl die unmittelbare finanzielle Lage nach der Scheidung (Vermögen + ggf. Unterhalt) als auch die langfristige Absicherung (Rente, Pension) im Blick behalten und fair verteilen.
Vermögensaufteilung bei internationalen Ehen
Welches Recht gilt?
Bei binationalen Paaren oder wenn ein Ehepaar im Ausland gelebt hat, stellt sich die Frage: Nach welchem Recht richtet sich die Vermögensaufteilung? Hier kommt das internationale Privatrecht ins Spiel. In der EU existiert seit 2019 eine einheitliche Regelung für den ehelichen Güterstand (EU-Güterstandsverordnung), an der Österreich teilnimmt. Demnach kann ein Ehepaar durch Rechtswahl das anwendbare Recht bestimmen (z. B. österreichisches Recht, wenn einer Österreicher ist). Haben sie keine Rechtswahl getroffen, gilt grundsätzlich das Recht des Staates, in dem die Ehegatten nach der Heirat ihren ersten gewöhnlichen Aufenthalt hatten, oder andernfalls das Recht der gemeinsamen Staatsangehörigkeit. Ist auch das nicht eindeutig, können weitere Anknüpfungspunkte greifen.
Beispiel: Ein österreichischer Staatsbürger heiratet eine Deutsche, und sie wohnen zunächst in Deutschland. Dann ziehen sie nach Österreich. Wenn keine Rechtswahl getroffen wurde, könnte nach der EU-Verordnung deutsches Güterrecht gelten (weil erster gewöhnlicher Aufenthalt in Deutschland), was den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft bedeuten würde. Das heißt, im Scheidungsfall würde nicht österreichisches EheG angewandt, sondern deutsches Recht, obwohl die Scheidung vielleicht in Österreich durchgeführt wird. Umgekehrt, zwei Deutsche, die in Österreich leben, könnten im Scheidungsfall österreichisches Recht anwenden müssen, wenn kein gemeinsamer erster Aufenthalt in Deutschland vorlag. Allerdings wird es in der Praxis häufig so sein, dass man versucht, sich auf ein Recht zu einigen, um Klarheit zu haben.
Wichtig: Man kann durch Ehevertrag explizit festlegen, welches Recht für den Güterstand gelten soll (Rechtswahl). Das ist sehr zu empfehlen bei internationalen Konstellationen, um spätere komplizierte Streitigkeiten darüber zu vermeiden.
Die Gerichtsstandfrage ist wieder ein anderes Thema: Welches Gericht ist zuständig? Für Scheidungen in der EU gibt es eigene Zuständigkeitsregeln. Oft kann eine Scheidung (und damit auch die Vermögensaufteilung) in mehr als einem Land theoretisch stattfinden – z. B. im Heimatland beider oder im Aufenthaltsland. Hier lohnt ggf. eine Beratung, wo die Scheidung günstiger ist oder welches Recht vorteilhafter wäre.
Anerkennung ausländischer Entscheidungen
Hat ein ausländisches Gericht bereits über die Vermögensaufteilung entschieden, stellt sich die Frage der Anerkennung in Österreich. Innerhalb der EU (bei Teilnehmerstaaten der Güterstandsverordnung) werden Entscheidungen zur ehelichen Vermögensaufteilung in der Regel gegenseitig anerkannt. Das bedeutet, wenn ein deutsches Gericht eine Entscheidung zum Zugewinnausgleich trifft, ist diese auch in Österreich vollstreckbar, ohne neues Verfahren. Man muss sie lediglich formell anerkennen lassen, was meistens reibungslos erfolgt.
Außerhalb der EU oder wenn ein Staat nicht an diesen Regelungen teilnimmt, kann es komplizierter sein. Aber Österreich erkennt ausländische Scheidungsurteile grundsätzlich an (sofern das Verfahren rechtsstaatlich war und die Zuständigkeit gegeben). Die vermögensrechtlichen Aspekte werden dann entweder in diesem Urteil mitgeregelt (und dann ebenfalls anerkannt) oder man muss die Vermögensaufteilung separat in Österreich beantragen.
Ein wichtiger Punkt: Immobilien unterliegen in der Regel dem Recht des Belegenheitsortes. Eine in Österreich gelegene Liegenschaft kann also in eine ausländische Scheidungsentscheidung möglicherweise nicht effektiv einbezogen werden. Österreichische Gerichte betonen, dass auch ausländische Immobilien grundsätzlich in die Aufteilung einbezogen werden können. Andersherum kann eine in Österreich gelegene Immobilie zum Problem werden, wenn z. B. ein US-Gericht die Scheidung macht – eventuell muss dann in Österreich separat geklagt werden, um die Eigentumsübertragung vorzunehmen, da ein US-Urteil allein im Grundbuch vollzogen zu bekommen schwierig sein könnte.
Insgesamt sind internationale Sachverhalte sehr komplex. Empfehlenswert ist hier immer eine anwaltliche Beratung, die sowohl mit österreichischem Recht als auch mit dem anderen betroffenen Rechtssystem vertraut ist. So kann man rechtzeitig vorsorgen und im Scheidungsfall die Aufteilung so reibungslos wie möglich gestalten.
Praxisbeispiele und Gerichtsurteile
Zur Veranschaulichung folgen einige typische Beispiele aus der Praxis und wichtige Grundsätze aus Gerichtsentscheidungen:
- Beispiel 1 – Eingebrachtes Haus mit Wertsteigerung: Frau A bringt ein Haus (Wert bei Eheschließung €150.000) in die Ehe ein. Während der 20-jährigen Ehe zahlen beide Ehegatten gemeinsam den noch laufenden Kredit ab und investieren in Renovierungen, sodass das Haus bei Scheidung €300.000 wert ist. Laut § 82 EheG bleibt das Haus an sich ihres (eingebrachtes Vermögen). Jedoch wurde der Wert durch gemeinsame Anstrengungen verdoppelt. Ergebnis in einem echten Fall: Die Wertsteigerung von €150.000 wird hälftig geteilt. Frau A behält das Haus, muss aber an Mann A €75.000 Ausgleich zahlen, um dessen Anteil am Zugewinn abzugelten.
- Beispiel 2 – Kurze Ehe ohne gemeinsame Errungenschaften: Ehepaar B war 2 Jahre verheiratet, keine Kinder. Beide behielten weitgehend getrennte Kassen. Sie trennten sich, ohne während der Ehe größere Anschaffungen zu machen. Hier entschied das Gericht: mangels nennenswerter ehelicher Ersparnisse gibt es nichts aufzuteilen. Jeder behielt sein Eigenes; kleine gemeinsame Anschaffungen (TV, Couch) einigten sie sich privat. Dieses Beispiel zeigt: Das Aufteilungsverfahren ist kein Automatismus, der immer angewendet werden muss – wenn kein aufzuteilendes Vermögen vorhanden oder alles minimal ist, wird es praktisch obsolet.
- Beispiel 3 – Verheimlichte Ersparnisse: In Fall C hatte der Ehemann kurz vor der Scheidung €30.000 vom gemeinsamen Konto auf ein Auslandskonto abgezogen, in der Hoffnung, dies entziehe sich der Aufteilung. Die Ehefrau bekam Wind davon. Das Gericht rechnete die €30.000 dennoch dem ehelichen Vermögen hinzu (nach § 91 EheG), da es sich um eine illoyale Vermögensminderung handelte. Ergebnis: Der Mann musste der Frau die Hälfte dieses Betrags (also €15.000) zusätzlich zu den übrigen Aufteilungswerten zahlen, obwohl das Geld „weg“ war. Diese Entscheidung verdeutlicht: Manipulationen lohnen nicht – das Gericht stellt auf den fiktiven Zustand ab, wenn jemand treuwidrig Vermögen weggeschafft hat.
- Beispiel 4 – Schuldenaufteilung bei Negativvermögen: Paar D hat während der Ehe mehr Schulden als Vermögen angehäuft (z. B. gemeinsamer Konsumkredit über €20.000, dem nur geringes Vermögen gegenübersteht). Bei Scheidung sind noch €15.000 Kredit offen und nur €5.000 Erspartes vorhanden. Hier wurde entschieden, dass das Ersparte 50:50 geteilt wird (je €2.500) und die Restschuld von €15.000 ebenfalls hälftig zu tragen ist. Praktisch übernahm jeder €7.500 Schulden. Da der Kredit auf beider Namen lief, zahlten sie den weiterhin gemeinsam ab, aber intern war klargestellt, dass jeder die Hälfte trägt. Hätte der Kredit nur auf einen Namen gelautet, hätte das Gericht im Innenverhältnis den anderen verpflichtet, die Hälfte der Raten an den Schuldner zu erstatten. Dieses Beispiel zeigt, dass auch Schulden fair „aufgeteilt“ werden.
- Gerichtsgrundsatz – Zugehörigkeit von Schulden: Der OGH hat festgehalten, dass es bei Schulden im Aufteilungsverfahren nicht darauf ankommt, wer Vertragspartner des Gläubigers ist. Entscheidend ist allein, ob die Schuld für eheliche Anschaffungen oder Lebensaufwand aufgenommen wurde. Damit wird verhindert, dass ein Partner sich aus der Verantwortung stiehlt, nur weil ein Kredit formal auf den anderen läuft. Relevant ist der Zweck der Schuld.
- Gerichtsgrundsatz – Vorkaufsrechte bei Ausgleichszahlung: Wenn ein Partner dem anderen die Hälfte einer Liegenschaft auszahlt, um Alleineigentümer zu werden, gilt dies nicht als Verkauf im zivilrechtlichen Sinn. Das bedeutet, ein im Grundbuch eingetragenes Vorkaufsrecht (z. B. der Gemeinde oder eines Verwandten) wird dadurch nicht ausgelöst. Die interne Ausgleichszahlung ist also „privat“ zwischen den Ex-Partnern und hindert den Eigentumsübergang nicht.
- Gerichtsgrundsatz – Ehewohnung-Definition: Selbst eine Wohnung, die die Ehegatten während der Ehe (z. B. aufgrund von Umständen) niemals gemeinsam bewohnt haben, kann als Ehewohnung gelten, wenn sie eigentlich für das gemeinsame Wohnen vorgesehen war. Üblicherweise ist die Ehewohnung der Ort, an dem man zusammenlebt. In einem OGH-Fall wurde aber festgehalten, dass auch eine nicht benutzte Wohnung Ehewohnung sein kann, wenn die Absicht bestand, sie gemeinsam zu nutzen. (Eine andere Entscheidung schränkt dies allerdings wieder ein – hier sind die Gerichtsmeinungen differenziert.)
Checkliste: Was ist vor der Vermögensaufteilung zu klären?
- Vermögensverzeichnis erstellen: Beide Partner sollten eine vollständige Liste aller Vermögenswerte und Schulden aufstellen: Konten, Sparbücher, Wertpapiere, Immobilien, Autos, Versicherungen, Möbel, etc. Transparenz ist der erste Schritt.
- Zugehörigkeit prüfen: Zu jedem Posten notieren: Wurde es während der Ehe angeschafft/erspart? Oder war es schon vorher da, geerbt, geschenkt? So lässt sich abgrenzen, was in die Aufteilung fällt.
- Aktuelle Werte ermitteln: Für wesentliche Vermögenswerte aktuelle Marktwerte feststellen (Immobilien schätzen lassen, Kontostände erheben, Fahrzeugwert z. B. via Gebrauchtwagenindex, etc.). Nur mit realistischen Werten kann fair geteilt werden.
- Bedürfnisse beachten: Überlegen, wer was wirklich benötigt. Etwa: Kann ein Partner finanziell alleine kein neues Zuhause stemmen? Dann wäre es sinnvoll, dass dieser Partner die Ehewohnung behält. Oder: Wer braucht welches Auto dringender? Solche Überlegungen fließen idealerweise in eine Einigung ein.
- Schuldenregelung: Bei Krediten: Klären, ob einer den Kredit übernehmen kann (Bonität, Bereitschaft der Bank) oder ob verkauft/abgelöst werden muss. Hier frühzeitig mit der Bank Kontakt aufnehmen.
- Möglichkeit der Einigung ausloten: Ein erstes Gespräch (sofern machbar) zwischen den Ehegatten kann helfen zu sehen, ob die Positionen weit auseinanderliegen oder nicht. Gegebenenfalls einen Mediator oder neutralen Dritten hinzuziehen.
- Rechtsrat einholen: Gerade bei viel Vermögen oder komplexen Verhältnissen sollte jeder sich anwaltlich beraten lassen, bevor etwas unterzeichnet wird. So kennt man seine Rechte und kann Fehler vermeiden.
- Zeitplan abstimmen: Überlegen, wann welche Schritte passieren sollen (z. B. „Wer zieht wann aus?“, „Bis wann soll das Haus verkauft sein?“, „Wann teilen wir die Konten auf?“). Ein geordneter Fahrplan beugt Chaos vor.
- Emotionen managen: Vermögensaufteilung ist sachlich, aber oft von Emotionen überlagert. Wichtig ist, persönliche Kränkungen soweit möglich auszuklammern und pragmatisch zu bleiben – notfalls professionelle Hilfe (Therapeut, Mediator) in Anspruch nehmen, um die Verhandlungen nicht entgleisen zu lassen.
Beratung und rechtliche Unterstützung
Wann zum Anwalt?
Einen Fachanwalt für Familienrecht einzuschalten, ist insbesondere dann sinnvoll, wenn die Vermögensaufteilung komplex oder strittig ist. Spätestens wenn klar wird, dass keine einfache Einigung möglich ist, sollte jeder Ehepartner sich individuell beraten lassen. Der Anwalt kann die Rechtslage erklären, realistische Vorschläge zur Aufteilung machen und vor finanziellen Nachteilen bewahren.
Auch wer eine einvernehmliche Lösung anstrebt, kann vorher zum Scheidungsanwalt gehen, um sich über seine Rechte und einen fairen Rahmen zu informieren. Manchmal genügt eine Beratung, um dann in Eigenregie eine Einigung zu finden, die anschließend notariell beurkundet wird. In anderen Fällen kann der Anwalt für einen Ehegatten den Entwurf einer Scheidungsfolgenvereinbarung erstellen, der dann mit der Gegenseite verhandelt wird.
In Gerichtsverfahren zur Vermögensaufteilung ist zwar die anwaltliche Vertretung in Österreich – theoretisch – nicht zwingend vorgeschrieben (Außerstreitverfahren), praktisch aber hoch anzuraten. Ohne Anwalt ist es schwierig, die eigenen Ansprüche vollständig durchzusetzen oder sich gegen Forderungen der Gegenseite zu wehren. Zudem kennt ein erfahrener Anwalt die Bewertungsspielräume und Kniffe (z. B. was man als Ausgleich fordern kann, wie man einen Vergleich optimal gestaltet).
Wer finanziell knapp bei Kasse ist, kann beim Gericht Verfahrenshilfe beantragen. Dann werden die Anwaltskosten ganz oder teilweise von Staat übernommen (je nach Einkommen/Vermögen). Dies sollte man nutzen, wenn man sonst unvertreten wäre – das Formular dafür kann beim Gericht eingebracht werden.
FAQ: Vermögensaufteilung bei Scheidung
Wer bekommt das Haus bei der Scheidung?
Das kommt auf die Umstände an. Bei gemeinsamer Eigentümerschaft kann einer das Haus übernehmen und den anderen auszahlen, oder das Haus wird verkauft und der Erlös geteilt. Gehört das Haus nur einem Ehepartner, bleibt es grundsätzlich diesem – allerdings kann der andere u. U. ein Wohnrecht oder eine Entschädigung erhalten, besonders wenn Kinder dort bleiben sollen. Die Entscheidung hängt von Bedürftigkeit, Beiträgen und Vereinbarungen ab.
Was passiert mit Schulden bei einer Scheidung?
Schulden werden entsprechend ihrem Zweck aufgeteilt. Haben beide für einen gemeinsamen Kredit gehaftet, wird meist vereinbart, dass derjenige, der das finanzierte Objekt behält, auch die Schuld übernimmt (oft gegen Ausgleich). Läuft ein Kredit nur auf einen Partner, kann intern geregelt werden, dass der andere die Hälfte mitträgt, sofern der Kredit für die Ehe aufgenommen wurde. Persönliche Schulden bleiben beim jeweiligen Partner.
Fallen Erbschaften und Geschenke in die Vermögensaufteilung?
Nein, persönliche Erbschaften oder Schenkungen an einen Ehepartner sind von Gesetzes wegen ausgenommen. Diese bleiben beim Empfänger und müssen nicht geteilt werden. Nur wenn das Geld z. B. ins gemeinsame Haus investiert wurde, kann der Wertzuwachs berücksichtigt werden. Aber die Erbschaft an sich teilt man nicht.
Was ist, wenn ein Ehepartner nie gearbeitet hat?
Auch ein nicht erwerbstätiger Partner hat volles Anrecht auf die Hälfte des gemeinsamen Vermögens. Haushaltsführung und Kindererziehung zählen als gleichwertiger Beitrag. Das Gesetz stellt sicher, dass z. B. eine Hausfrau nach 20 Jahren Ehe nicht leer ausgeht, nur weil sie kein Einkommen hatte. Ihr Beitrag wird bei der Aufteilung berücksichtigt, sodass sie in der Regel 50% des ehelichen Vermögens erhält.
Müssen wir die Vermögensaufteilung sofort bei der Scheidung machen?
Im Idealfall ja – bei einer einvernehmlichen Scheidung muss die Aufteilung sogar Bestandteil der Scheidungsvereinbarung sein. Wenn man sich aber noch nicht einigen kann, hat man bis zu einem Jahr nach Rechtskraft der Scheidung Zeit, die Aufteilung gerichtlich zu beantragen. Wartet man länger als ein Jahr, verliert man den Anspruch! Es empfiehlt sich daher, die Vermögensfrage möglichst zeitnah zu klären.
Brauche ich einen Anwalt für die Vermögensaufteilung?
Es ist zumindest ratsam. Bei einvernehmlicher Scheidung mit unkomplizierten Vermögensverhältnissen kann man theoretisch ohne Anwalt auskommen. Aber um sicherzugehen, dass Sie Ihre Rechte kennen und nichts übersehen wird, ist anwaltlicher Rat sehr hilfreich. Bei strittiger Aufteilung vor Gericht ist ein Anwalt nahezu unerlässlich, um Ihre Interessen zu vertreten.
Kann man einen vereinbarten Aufteilungsvertrag später ändern?
Grundsätzlich nein, ein sauber geschlossener Scheidungsvergleich zur Vermögensaufteilung ist endgültig und bindend. Nachträglich kann keiner kommen und mehr fordern. Nur wenn sich herausstellt, dass etwas arglistig verschwiegen wurde (z. B. ein verstecktes Konto), könnte ggf. der Vertrag angefochten werden. Das sind aber Ausnahmefälle, die juristisch kompliziert sind. Im Normalfall gilt: Vereinbart ist vereinbart.
Quellen
- Österreichisches Bundesportal oesterreich.gv.at
- Ehegüterrecht und partnerschaftliches Vermögen: Abschnitte „Aufteilung bei Trennung“ und „Sonderregelung für Wohnraum“, Stand 1.1.2025
- „Allgemeines zur streitigen Scheidung“, Abschnitt Vermögensaufteilung: Hinweis, dass Aufteilungsansprüche nur innerhalb eines Jahres nach Rechtskraft der Scheidung geltend gemacht werden können.
- Rechtsinformationssystem (RIS) des Bundes
- Ehegesetz (EheG) §§ 81–83 – Gesetzestext §81 definiert das eheliche Gebrauchsvermögen und die ehelichen Ersparnisse, §82 listet von der Aufteilung ausgenommene Gegenstände, §83 umschreibt die Aufteilungsgrundsätze (Billigkeit).
- Oberster Gerichtshof (OGH)-Entscheidungen:
- RS0130671 zur Wertsteigerung fremdfinanzierter Liegenschaft durch Kredittilgung während Ehe
- RS0057486 zur Definition „eheliche Errungenschaft“ (bis Aufhebung d. Gemeinschaft Erspartes)
- RS0131955 zu Schulden in Aufteilung (entscheidend ist Zweck, nicht wer Schuldner ist),
- RS0117304 zur Ehewohnung im Fremdeigentum (benutzt von beiden = eheliches Gebrauchsvermögen, unabhängig von Eigentumstitel).
- IEF (Institut für Ehe und Familie)
- „Getrennte Wege nach Ehescheidung – Vermögensaufteilung“ (Bericht Jour Fixe 05.06.2023, Doris Täubel-Weinreich, Richterin): Informationen zum Ablauf des Aufteilungsverfahrens, Fristen (Antrag binnen 1 Jahr) und Bewertungsstichtag (Zeitpunkt der Entscheidung; Wertsteigerungen nach Trennung).
- „Getrennte Wege nach Ehescheidung – Vermögensaufteilung“ (Bericht Jour Fixe 05.06.2023, Doris Täubel-Weinreich, Richterin): Informationen zum Ablauf des Aufteilungsverfahrens, Fristen (Antrag binnen 1 Jahr) und Bewertungsstichtag (Zeitpunkt der Entscheidung; Wertsteigerungen nach Trennung).
- Taxlex Fachzeitschrift 2017, S.36f. (Sabine Kanduth-Kristen)
- Steuerliche Behandlung von Grundstücksübertragungen bei Scheidung. Insbesondere Grunderwerbsteuerregelung ab 1.1.2016 – Übertragungen im Zuge der Aufteilung gelten als unentgeltlich im Familienverband; es kommt der Stufentarif zur Anwendung (0,5%/2%/3,5%). Somit begünstigte Besteuerung bei Übernahme eines Immobilienanteils durch Ex-Partner.
- Steuerliche Behandlung von Grundstücksübertragungen bei Scheidung. Insbesondere Grunderwerbsteuerregelung ab 1.1.2016 – Übertragungen im Zuge der Aufteilung gelten als unentgeltlich im Familienverband; es kommt der Stufentarif zur Anwendung (0,5%/2%/3,5%). Somit begünstigte Besteuerung bei Übernahme eines Immobilienanteils durch Ex-Partner.
- jusline.at
Das sagen unsere Klienten
Mehr Rezensionen finden Sie auf unserem Google Profil
Kontaktieren Sie uns
Sie können uns telefonisch, per E-Mail oder per Kontaktformular erreichen.
Kanzlei IBESICH
Josefstädter Straße 11/1/16
1080 Wien
MO-FR: 9:00 – 18:00 Uhr
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenInsights aus der Kanzlei IBESICH
News aus der Kanzlei und rechtliche Updates in Österreich.